(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=29.04.2002 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 22.07.24
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail: sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & .Copyright
Anfang_ Aussagepsychologie_Datenschutz_ Überblick_ Rel. Aktuelles_ Rel. Beständiges _ Titelblatt_ Konzeption_ Archiv_ Region_ Service_iec-verlag___Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, Abteilung forensische Psychologie, Bereich
Aussagepsychologie
"Alle Menschen sind Lügner"
(Psalm
116,11)
"Die gefährlichsten Unwahrheiten sind Wahrheiten,
mäßig entstellt."
Georg Christoph Lichtenberg, (1742 – 1799), Vermischte
Schriften I, 3
"Die durchgängige besonnene Scheidung zwischen
Gedächtnisvorstellung und Phantasievorstellung, zwischen Wahrheit
und Dichtung ist eine der höchsten und schwierigsten Aufgaben intellektueller
und ethischer Kultur."
(Jodl, Fr. (1903) Lehrb. d. Psychol., 2. Anfl. II, 162.)
„Die fehlerlose Erinnerung ist nicht die Regel, sondern
die Ausnahme."
William Stern 1902 in der Zeitschrift für die gesamte
Strafrechtswissenschaft, S. 327
"Von den ersten Vernehmungen hängt also geradezu
die ganze Zukunft des Prozesses ab:
In ihnen wird eigentlich fast immer der Sachverhalt
endgültig geklärt oder endgültig verschleiert"
William Stern (1926,47).
„Der Irrtum ist der größte Feind der Wahrheitsfindung
vor Gericht."
Rolf Bender, 1982, Strafverteidiger 1982
"'Das habe ich getan', sagt mein Gedächtnis, 'das
kann ich nicht getan haben' -
sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich -
gibt das Gedächtnis nach."
Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, Nr. 68
Originalarbeit von Rudolf
Sponsel, Erlangen
Querverweise
- Überblick
- Einführung.
- Grundlegende Unterscheidung zwischen Glaubhaftigkeit und Glaubwüdigkeit.
- Das Grundproblem wie William Stern es schon 1903 formuliert hat.
- Geschichte der Aussagepsychologie.:
- Nach Stern (1926).
- Nach Undeutsch (1967).
- Nach Arntzen (1993).
- Nach Steller (1988).
- BGH (1999).
- Aktuell (2024)?
- Was sind Aussagen?.
- Verschiedene Aussageumfänge.
- Darstellung von Aussagen zur Aussageanalyse.
- Vergleichende Aussagenanalyse.
- Der Druck der ErmittlerInnen, Aussagen zu gewinnen.
- Die Bedeutung der Erstaussage.
- Die Aufgabe der AussagepsychologInnen nach dem BGH.
- Probleme der Methodik und der Hypothesenprüfung:
- Die großen Hypothesen der Aussagepsychologie.
- Voraussetzungen der Hypothesenprüfung.
- Die Grundaufgabe der Hypothesenprüfung.
- Möglichkeiten und Methoden der Hypothesenprüfung.
- Fachliche Ausführungen zur Hypothesenprüfung bei aussagepsychologischen Fragestellungen.
- Aussage-, Wahrnehmungs-, Gedächtnis- und Kommunikationspsychologie.
- Erklärungsmodelle für Erinnerungsverluste.
- Motive oder Gründe für falsche Erinnerungen.
- Grundlegende Gedächtnismodelle und Typen.
- Aussgagepsychologie und Phantasie. Erste Hypothesen. [externer Link]
- Die 12 'Verbote' (‘Hauptsünden’) in der Vernehmung (Exploration).
- Lügendetektion.
- Literatur.
- Videos.
- Querverweise.
- Aussgepsychologische Wahrheitstheorie 1. Systematik der Falsch-Aussagen.
- Suggestion und Suggestivfragen. Aussagepsychologische und vernehmungstechnische Kunstfehler.
- Kinder und ZeugInnen richtig befragen bei sexuellem Mißbrauch / Vergewaltigung.
- Der Schutz kindlicher Opferzeugen im Strafverfahren und die Verwendung von Videotechnologie. Die Dissertation von Kipper. Mit einem kritischen Kommentar und Aufruf von Rudolf Sponsel: Mauern Staatsanwaltschaften und Justiz zum Schaden unserer Kinder?
- Andere forensische Beweis-Methoden und Indizienquellen.
- Überblick: Forensische Diagnostik, Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie in der GIPT.
Einfuehrung: So wie der Bäcker Mehl braucht, ein Tankwart Benzin, der Richter Gesetze, so braucht die AussagepsychologIn für ihre Arbeit - wie der Name schon sagt - Aussagen, sonst kann sie keine Prüfung vornehmen, ob die Gesamtaussage genügend Realkennzeichen enthält, so daß wenigstens erst einmal auf einen subjektiv wahren Erlebnisbericht geschlossen werden darf. Beachten Sie bitte das Wörtchen subjektiv, es ist hier sehr wichtig. AussagepsychologInnen ermitteln nämlich keine objektiven Wahrheitswertungen, das ist Sache des Gerichts, sondern nur subjektive. Auch wenn ein Zeuge subjektiv die Wahrheit sagen mag, so folgt daraus keineswegs, daß seine subjektiv wahre Aussage gleichbedeutend mit den Tatsachen ist. Wenn jemand z.B. nach dem Sternzeichen einer entfernten Verwandten gefragt wird, dann kann dieser Jemand felsenfest überzeugt und subjektiv wahrhaftig aussagen, die Verwandte sei im Zeichen des Stiers geboren und trotzdem kann dies natürlich falsch sein, weil sich der Betreffende irrt.
Der Hauptfeind der Wahrheit, wenn man es nicht gerade mit abgebrühten Ganoven zu tun hat, ist nicht die Lüge, sondern der Irrtum. Bezeichnenderweise hat Prof. Rolf Bender, juristischer Vernehmungs- und Aussageexperte, sein im Strafverteidiger 1982 veröffentlichtes Wirklichkeitsexperiment mit folgendem trefflichen Titel versehen: „Der Irrtum ist der größte Feind der Wahrheitsfindung vor Gericht."
Grundlegende Unterscheidung
zwischen Glaubhaftigkeit und Glaubwüdigkeit
Glaubwürdigkeit ist ein Persönlichkeitsmerkmal,
Glaubhaftigkeit ist ein Aussagemerkmal. Die "moderne" Aussagepsychologie
untersucht in erster Linie Glaubhaftigkeit und weniger Glaubwürdigkeit,
obwohl auch diese eine Rolle spielen kann (z.B. Zeugenaussagen von Bandenmitgliedern).
Im allgemeinen gelten Personen mit "gutem Ruf (Leumund)", z.B. Adelige,
Höher Gebildete, Reiche, Mächtige, Richter, Staats-/Anwälte,
Polizisten, Ärzte, Psychologen, Gutachter, Pfarrer, Beamte, Geschäftsleute,
Professoren und Doktoren, als glaubwürdig, Personen aus Milieus mit
weniger gutem Ruf, Kriminelle, Rotlichtmilieu, Unterschichtsangehörige,
Prekariatsangehörige, Außenseiter, "Spinner", psychisch Kranke,
Minderbemittelte und Minderbegabte, als weniger glaubwürdig. Diese
Unterschiede und Vorurteile kennt die moderne Aussagepsychologie nicht.
Für sie ist klar, dass Adelige, Höher Gebildete, Reiche, Mächtige,
Richter, Staats-/Anwälte, Polizisten, Ärzte, Psychologen, Gutachter,
Pfarrer, Beamte, Geschäftsleute, Professoren und Doktoren ebenso
lügen oder verleugnen können wie Kriminelle, Rotlichtmilieuangehörige,
Unterschichtsangehörige, Prekariatsangehörige, Obdachlose, Außenseiter,
"Spinner", psychisch Kranke, Minderbemittelte und Minderbegabte die Wahrheit
sagen können.
Das Grundproblem wie
William
Stern es schon 1903 formuliert hat
gesperrt hier fett, S. 47-49.
"A. Die Beurteilung der Aussagen und der Aussagenden.
Die erste Leistung, welche die Forschung hier zu vollziehen hat, ist
eine negative: Erschütterung gewisser einfacher Formeln, nach denen
der natürliche Menschenverstand die Aussagen logisch und ethisch zu
bewerten geneigt ist. Diese [>48] Formeln der naiven Beurteilung lauten
etwa: 1. Eine mit bestem Wissen und Gewissen gegebene Aussage ist im allgemeinen
als korrekte Wiedergabe der Wirklichkeit anzusehen. 2. Eine mit Überlegung
gegebene Aussage, die sieh als falsch erweist, ist als beabsichtigte Fälschung
(Lüge, Meineid) oder mindestens als strafbare Fahrlässigkeit
anzusehen.
Im ersten Falle mufs eine unberechtigte Vertrauensseligkeit
und Bequemlichkeit, im zweiten Falle ein unberechtigter Rigorismus bekämpft
werden;. dies tut die Forschung, indem sie folgende beide Sätze nachweist,
mit Beispielen belegt und eindringlichst denen, die über Aussagen
zu urteilen haben, zu Gemüte führt:
I. Es. gibt eine natürliche normale Aussagefälschung
ohne Wissen und Willen von breitem Umfang; deshalb ist einerseits auch
bei ethisch durchaus einwandfreien Aussagen, mit einem Fehlerprozentsatz
zu rechnen, andererseits bei nachweislich falschen Aussagen stets die Möglichkeit
völlig absichtsloser Selbsttäuschung in Betracht zu ziehen.
IL Es gibt pathologische Aussagefälschungen
ohne Wissen und Willen in noch viel weiterem Umfange; deshalb ist "bei
der logischen und ethischen Bewertung von Aussagen eine eventuelle pathologische
Beschaffenheit des Aussagenden gebührend zu berücksichtigen.
Dafs so die Aussagepsychologie mit einer wesentlich
destruktiven Leistung anhebt, ist fraglos; und viele, namentlich Praktiker,
welche wohl diese eine, zunächst sich aufdrängende Wirkung beachteten,
sehen daher in derartigen wissenschaftlichen Untersuchungen geradezu eine
verhängnisvolle Bedrohung praktisch-positiver Kulturbetätigung;
vor allem scheint die Anzweiflung des Objektivitätswertes der normalen
und gutgläubigen Zeugenaussage die forensische Wahrheitsfindung und
damit überhaupt eine fruchtbare Durchführung des Strafprozesses
illusorisch zu machen.
Aber wenn irgendwo, so dürfen wir gerade bei
der Aussageforschung der Hoffnung leben, dass das unserem ersten Aufsatz
vorgesetze Motto sich bewähre. So sehr die Forschung destruktiv zu
wirken scheint, während sie am Werke ist, so sicher werden
ihre schließlichen Ergebnisse zu neuem Aufgaben führen; sie
werden an Stelle der diaktischen Beurteilungs[>49] kriterien neue und zuverlässigere
setzen.1 Das kann z. B. die Geschichtswissenschaft lehren, welche schon
lange das hat; was die Kriminalistik braucht, eine wissenschaftlich fundierte
Quellenkritik — die aber durch diese Kritik nicht ein geringeres, sondern
ein reicheres, dabei gesicherteres, objektiveres Wissen erworben hat.
Um solche positiven Beurteilungskriterien der Aussagen
zu erarbeiten, hat sich die psychologische Forschung die Frage vorzulegen,
in
welchem Grade und welchem Sinne Richtigkeit und Fehlerhaftigkeit der Aussagen
abhängen von den verschiedenen Bedingungen, die an ihrem Zustandekommen
beteiligt sind. Solcher Bedingungen gibt es drei Gruppen; denn die Beschaffenheit
einer Aussage hängt ab FN1. von dem Gegenstande, auf welchen
sie sich bezieht, 2. von den formalen Bedingungen, unter denen die
Wahrnehmung und die Aussage selbst vor sich geht, 3. von den Personen,
die sie abgeben. Eine blofse Aufzählung der Einzelmomente, die unter
diese drei Gruppen fallen, zeigt, welche Fülle von Aufgaben hier der
Untersuchung harrt."
Geschichte der Aussagepsychologie
Nach Stern (1926), S.7
I. Übersicht über Entwicklung und gegenwärtigen Stand
des Problems
1. Von der experimentellen Aussagepsychologie zur praktischen Zeugen
Psychologie
Der Anstoß dazu, daß die Frage des nicht-erwachsenen
Zeugen gesonderte Beachtung, wissenschaftliche Erforschung und schließlich
praktische Auswirkung erfuhr, kam zweifellos von der Psychologie. Selbstverständlich
haben zu alten Zeiten Juristen, die sich mit strafprozessualen Dingen beschäftigten,
auch die Vernehmung von Jugendlichen erörtert; aber dies geschah doch
immer nur gelegentlich und ohne spezielle — wissenschaftliche und praktische
— Bemühung um das Thema. Erst als die psychologische Forschung
im Anfang des Jahrhunderts von experimentellen Untersuchungen über
Wahrnehmung, Erinnerung, Suggestion usw. zu einer „Psychologie der Aussage“
durchstieß, wurde alsbald die Erweiterung dieser Untersuchungen vom
Erwachsenen auf das Kind und die Anwendung auf forensische Tatbestände
und Bedürfnisse vorgenommen.
Binets Buch über die Suggestibilität ([61]
1900) und meine Abhandlung über „Die Aussage als geistige Leistung
und als Verhörsprodukt“ ([73] 1903) stehen am Anfang einer langen
Reihe von Experimentaluntersuchungen, die dem Unerwachsenen verschiedener
Altersstufen, verschiedener Schichten, beider Geschlechter galten, die
die Aussagen über Bilder, Örtlichkeiten, Zeitdauern, Vorgänge,
Gegenstände prüften, die Erinnerungstreue und -Untreue in ihrer
Abhängigkeit von äußeren und inneren Bedingungen studierten,
den Einfluß der Aufmerksamkeit, des Interesses, der Suggestion usw.
untersuchten.
Von dieser umfangreichen wissenschaftlichen Arbeit
eines Vierteljahrhunderts soll auf den folgenden Seiten nicht im ein¬zelnen
die Rede sein. Sie ist an manchen anderen Stellen zu-sammenfassend behandelt;
gute Übersichten gewähren die Bücher von Stöhr ([17]
1911), Schrenk ([11] 1922) und Gorphe ([2] 1924). ..."
Nach Undeutsch (1967)
Erste Phase 26-42, 1834 mit Mittermaier bis Stern 1926.
Zweite Phase 42-43, 1930 bis Ende 2. Weltkrieg.
Dritte Phase 43-48, ab 1945 breiter Durchbruch der psychologischen
Kompetenz. Undeutsch S.44f:
"Die dritte Phase kann ihrem sachlichen Ertrag nach gekennzeichnet
werden als der Durchbruch der Erfahrung auf breiter Front.
Nicht ohne Bedeutung dafür war ein Artikel des bekannten Kölner
Krimi-nalwissenschaftlers Bohne, der im Januar 1949 in der Süddeutschen
Juristen-Zeitung erschienen war. Er vertrat mit eindrucksvollen Argumenten
die Forderung:
„Solange nun allerdings ein wenigstens weitgehender Ersatz
des Zeugenbeweises durch den materiellen Spurenbeweis in der Praxis nicht
erwartet werden kann, muß ein anderer Weg gesucht werden, die im
Zeugenbeweis liegenden Fehlermöglidi- keiten und tatsächlichen
Mängel dadurch zu eliminieren, daß auch er in weitem Umfang
unter die Begutachtung Sachverständiger gestellt wird“ (9).
Zugleich plädierte er dafür, daß
diese Begutachtung den Psychologen über-tragen werde:
„Sofern es sich um eine Aussageperson handelt, die nicht
im Verdacht psycho-pathologischer Regelwidrigkeit steht, ... kann es keinem
Zweifel unterhegen, daß dieser ,normale' Ablauf psychischer Funktionen
... in das Fachgebiet des Psychologen und nicht des Psychiaters gehört,
mag der Psychiater auch, um die Grenzen seines Gebietes erfassen zu können,
vom ,Normalen' seinen Ausgang genommen haben, wie der Pathologe als Grundlage
seines Forschungsgebiets von der ,normalen' Anatomie und Histologie auszugehen
hat. Aber wie in diesem letzteren Fall niemand den [>] Pathologen als Sachverständigen
in rein anatomischen, histologischen und entwicklungsgeschichtlichen Fragen
proklamieren wird, so wenig kann dies hinsichtlich der Bewertung einer
Zeugenaussage durch den Psychiater zulässig sein“ (13)."
_
Nach Arntzen
(1993), S.3-8
"2. Neuere Geschichte der forensischen Aussagepsychologie
In geschichtlicher Hinsicht hat die ältere
Aussagcpsychologic, die vor allem durch Binet (1900), W. Stern (1902, 1904,
1926), O. Lipmann (1905), Marbe (1913), ?. Döring (1923) und P. Plaut
(1929) vertreten wurde, eine treffende Darstellung in mehreren Veröffentlichungen
von Undeutsch (1954, 1965, 1967) gefunden. Nur wenige Lehrmeinungen dieser
Epoche der Aussagepsychologie haben Bestand gehabt. Der Grund dafür
liegt eindeutig darin, daß die Autoren sich nur selten mit dem Zeugen
selbst befaßt haben. Sie beschränkten sich durchweg auf bloßes
Aktenstudium in einzelnen Strafsachen sowie auf Laborexperi¬mente und
hatten deshalb geringen Kontakt mit der forensischen Wirklichkeit. ...
[S.3]
Die eigentliche empirische
Fundierung und damit die entscheidende Ausweitung der Aussagcpsychologic
begann etwa 1948. Sie war eng verknüpft mit umfangreicher Gutachtertätigkeit
vor Gericht. ... [S.3]
Als 1950 vom Verfasser das erste Institut
für Gerichtspsychologie gegründet wurde, dessen Mitarbeiterstab
in den folgenden Jahrzehnten auf etwa 40 Gcrichtspsychologen anstieg, begann
man dort in weitem Umfang mit der systematischen Auswertung des Aussagematerials
aus Begutachtungsfällen und mit der Ausbildung von hauptberuflichen
Gerichtspsychologen. ... [S. 6]
S. 2 erwähnt, dass Arntzens
Material auf ca. 43000 Untersuchungen in 40 Jahren beruht.
_
Nach Steller (1988), S. 20f
"3. Ausblick in die vierte Phase der Aussagepsychologie
Undeutsch (1967) beschrieb drei Phasen aussagepsychologischer
Forschung und Praxis in Deutschland: experimentelle Untersuchungen zur
Aussagegenauigkeit von Kindern zu Beginn des Jahrhunderts (1. Phase) mit
dem Resultat einer allgemeinen Skepsis gegenüber Kinderaussagen in
der forensischen Praxis, gefolgt von einer Latenzphase [>22] mit dem Schwerpunkt
auf systematischer und hypothesengeleiteter empirischer und experimenteller
Forschung im Bereich der praxisrelevanten Glaubhaftigkeitsbeurteilung zu
stehen. In dem Bericht von Michaelis- Arntzen wurden dafür in Übereinstimmung
mit Köhnken und Wegener (1982, 1985) zwei grundsätzliche Strategien
verdeutlicht, die in weiteren Arbeiten eingesetzt werden sollten. Neben
dem globalen Validitätsnachweis für die Aussagenanalyse erscheinen
Arbeiten besonders wichtig, die den relativen Beitrag einzelner Realkennzeichen
für die Gesamtdiagnose sowie den Prozeß, der Bewertung und Verknüpfung
einzelner Aussageeigenarten zu Glaubwürdigkeitsmerkmalen (Michaelie-Arntzen
1987, S. 73) explizit machen. Dazu geeignete regressions- und diskriminanzanalytische
Bestimmungen setzen die exakte Definition und Operationalisierung der benutzten
Realkennzeichen voraus."
BGH
(1999)
Mit seinem bahnbrechenden Urteil zu wissenschaftlichen Anforderungen
an aussagepsychologische Begutachtungen (Glaubhaftigkeitsgutachten) hat
der BGH neue Maßstäbe gesetzt und die 5. Phase der Aussagepsychologie
eingeläutet.
BGH, Urt. vom 30. Juli 1999 - I StR 618/98 - LG Ansbach (StPO §
244 Abs. 4 Satz 2).
__
Aktuell (2024)
Seit der Proklamation der vieren Phase der Aussagesychologie
durch Steller sind nun rund 36 Jahre vergangen und es wäre interessant
zu wissen, wie sich die vierte oder gar schon 5. oder 6. Phase der Aussagepsychologie
heute darstellt. So ist etwa die Ausgabe der Rechtspsychologie 1, 24, dem
Schwerpunkt Innovative Methoden (z.B. Conjoint Analysen oder Virtuelle
Szenarien in der Rechtspsychologie) gewidmet. Es fehlt allerdings immer
noch eine klare Theorie und Ausarbeitung des Kernanliegens, wie man realerlebnisbegründete
Aussagen beweisen kann. Das ist zwar schwierig und berührt auch das
grundlegende Beweisthema im Recht, aber notwendig.
__
Was sind Aussagen ?
Nun, der Stoff für Anzeigen, Ermittlungen, Anklagen und Verurteilungen in solchen Verfahren sind Aussagen. Was sind nun Aussagen? Eine Elementaraussage ist z.B. „Da steht ein Tisch." Oder „Da lag ein Messer". Die Aussage „Der runde Tisch stand in der Ecke" ist bereits zusammengesetzt und enthält drei Elementaraussagen oder Details (Tisch, rund, in der Ecke). Ein wichtiges Realkennzeichen für eine Aussage, die auf subjektiv wahren Erlebnissen beruht, ist daher ihr sog. Detailreichtum, Nr. 3 bei Steller in seinem Gutachten für den Bundesgerichtshof und von diesem bestätigt wie alle anderen 18 auch.
Der juristische Begriff der "Aussage" ist leider ebenso unklar wie der allgemeine, der ebenfalls ein vielfältiges Homonym ist. Aber in der inhaltlichen Kernbedeutung stimmen juristische, wissenschaftliche, bildungssprachliche und alltägliche Bedeutung überein: Eine Aussage ist potentiell wahr oder falsch. Anders gesagt: Eine Aussage hat einen Wahrheitswert (Logik, Aussagenlogik), der aber nicht immer hinrfeichend sicher ermittelt werden kann (non liquet).
Verschiedene Aussageumfaenge
Elementar- oder Atomare Aussage (AA), Molekulare Aussage (MA), Handlungseinheit
(HA), Erlebnisaussage (EA), Gesamtaussage (GA), erste Gesamtaussage (1GA),
zweite Gesamtaussage (2GA), x-te Gesamtaussage (xGA). Spricht also jemand
von Aussage, sollte man genau nachfragen, von welcher Aussage oder welchem
Aussageteil die Rede ist.
Die einfachste Aussage nennen wir Elementaraussage.
Sie hat die einfache Form P(X), molekulare haben mehrere Zuordnungen: P1,
P2, ...(X). Von X wird mehreres, nicht nur ein einziges ausgesagt. Mehrere
Aussagen nacheinander bezeichnen wir als Aussagesequenz. Als Gliederung
von Aussagesequenzen könnten Themen oder Handlungseinheiten dienen.
Typische Handlungseinheiten (Standardsituationen) des Alltagslebens sind
z.B.: Aufwachen, Toilette, Anziehen, Frühstrücken, Packen, Auf
den Weg machen, Ankunft am Zielort, Handlungsverlauf am Zielort, Mittagspause,
Nachmittagsgestaltung, Heimweg, Besorgung, Ankunft daheim, Dieses und jenes,
Abendessen, Abendgestaltung, fertig machen zur Nachtruhe, Schlafen. Eine
Gesamtaussage kann man zu einem Thema zusammenfassen, z.B. Erlebnisse mit
dem Onkel in der letzten Zeit.
Beispiel-01 Aussagezerlegung
in atomare Elementaraussagen
Vernehmer: Erzählen Sie mal ... [perfekt offene Frage ohne jede
suggestive Vorgabe]
Zeuge zu Protokoll: Nachts auf dem Nachhauseweg hörte ich ein
Klirren und versuchte, herauszufinden, woher das kam und was es zu bedeuten
hat. Ich schaute mich um, mehrfach, horchte in verschiedene Richtungen.
Ich konnte es aber nicht orten. Plötzlich war es wieder, und mir war,
als käme es von vorne, rechts. Ich ging in die Richtung und sah, als
ob gerade jemand durch ein Fenster bei Müllers eindrang. Es rumpelte
etwas, als ob jemand gegen etwas stieß. Was ist denn da los, fragte
ich mich, bricht da etwa jemand ein? Müssten die Müllers das
nicht merken? Ich ging näher, da wurde mir mulmig, so dass ich lieber
die Polizei anrief, die nach ca. 25 Minuten auch kam. Ich erzählte
noch mal, was ich beobachtete. Sie klingelten. Mehrmals. Keine Reaktionen.
Schließlich stieg einer der zwei Polizisten durch das Fenster. Er
leuchtete mit einer Taschenlampe, wie man von außern schemenhaft
sehen konnte. Der Polizist hörte zunehmend lautere Schnarchgeräusche
aus einem Raum in dem ein Mann auf der Couch lag, der schlief und lauthals
schnarchte. Es roch stark nach Alkohol. Er kehrte zurück und sie meinten,
das sei wohl der Herr Müller, der wahrscheinlich im betrunkeken Zustand
seinen Hausschlüssel nicht fand und daher das Fenster einschlug, um
rein zu kommen. Das bestätigte sich auch am nächsten Tag.
Zerlegt man diese Zeugenaussage in ihre elementaren
Bestandteile, ergeben sich 8 Handlungsequenzen mit 71 Elementaraussagen:
Handlungssequenz H1 wahrnehmen eine unklaren Vorganges in der Nacht
- H1.01 Ich hörte
H1.02 ein Klirren
H1.03 versuchte
H1.04 herauszufinden
H1.05 woher es kam
H1.06 und was es zu bedeuten hat
H1.07 Ich schaute mich um
H1.08 mehrfach
H1.09 horchte
H1.10 in verschiedene Richtungen
H1.11 Ich konnte es aber nicht orten.
H1.12 Plötzlich
H1.13 war es wieder,
H1.14 und mir war, als käme
H1.15 es von vorne,
H1.16 rechts.
H1.17 Ich ging
H1.18 in die Richtung
H1.19 und sah
H1.20 als ob jemand
H1.21 durch ein Fenster
H1.22 bei Müllers eindrang.
H1.23 Es rumpelte
H1.24 etwas,
H1.25 als ob jemand gegen etwas stieß.
H1.26 Was ist denn da los,
H1.27 fragte ich mich,
H1.28 bricht da etwa jemand ein?
H1.29 Müssten die Müllers
H1.30 das nicht merken?
H2 Zu mulmig für einen Alleingang - Polizeiruf
- H2.01 Ich ging näher,
H2.02 da wurde mir mulmig,
H2.03 so dass ich lieber
H2.04 die Polizei anrief,
H2.05 die nach
H2.06 ca. 25 Minuten auch kam.
H3 Wiederholung der Beobachtungen für die
Polizei
- H3.01 Ich erzählte noch mal,
H3.02 was ich beobachtete.
H4 Die Polizei klingelt
- H4.01 Sie klingelten.
H4.02 Mehrmals.
H4.03 Keine Reaktionen.
H5 Ein Polizist steigt ein
- H5.01 Schließlich stieg einer der zwei Polizisten
H5.02 durch das Fenster.
H5.03 Er leuchtete mit
H5.04 einer Taschenlampe,
H5.05 wie man von außen
H5.06 schemenhaft
H5.07 sehen konnte.
H6 Laut schnarchende nach Alkohol riechender
Mann
- H6.01 Der Polizist hörte
H6.02 zunehmend
H6.03 lautere
H6.04 Schnarchgeräusche
H6.05 aus einem Raum
H6.06 in dem ein Mann auf der Couch lag,
H6.07 der schlief
H6.08 und lauthals
H6.09 schnarchte.
H6.10 Es roch
H6.11 stark
H6.12 nach Alkohol.
H7 Hypothese Schlüssel nicht gefunden
- H7.01 Er kehrte zurück
H7.02 und sie meinten,
H7.03 das sei wohl der Herr Müller,
H7.04 der wahrscheinlich
H7.05 im betrunkenen Zustand
H7.06 seinen Hausschlüssel
H7.07 nicht fand
H7.08 und daher das Fenster einschlug,
H7.09 um rein zu kommen.
H8 Bestätigung am nächsten Tag
- H8.01 Das bestätigte sich auch
H8.02 am nächsten Tag.
Darstellung von Aussagen zur Aussageanalyse
Zur Gliederung der Aussagen für die Aussageanalyse gibt es mehrere Möglichkeiten:
(1) Die übliche und einfachste Methode ist die der natürlichen Reihenfolge, so wie gefragt und geantwortet wurde. Diese kann man auch mit Überschriften, zu welchen Handlungssequenzen sie gehören, ausstatten. So werden Aussageprotokolle der Vernehmungen in den Akten auch gewöhnlich dargestellt. Das ist sozusagen das Aussagerohmaterial für den Sachverständigen.
(2) Will man speziell den Detaillierungsgrad etwas genauer - auch quantitativ - bestimmen, kann man die Aussagen in Elementaraussagen zerlegen. Diese kann man aber auch unter Handlungssequenzen einordnen, weil das eine das andere nicht ausschließt.
(3) Geht es um die wesentlichen Inhalte von Aussagen, erscheint die Methode nach sinnvollen Handlungssequenzen zu gliedern, empfehlenswert. Dies erleichtert bei mehreren Aussagen auch die Konstanzprüfung. Am besten zerlegt man die einzelnen Handlungssequenzen in ihre natürlichen Handlungsabfolgen, etwa wie folgt: Erwägung (Einfall/ Idee) => Entscheidung => Entschluss => Handlung: => Weg => Ankunft => Anfang Gestaltung => Verlauf Gestaltung 1,2,3, ... => Ende Gestaltung => Weg zurück => Nachherverhalten. Die Gliederung von Handlungssequenzen nach dem natürlichen Ablauf der Aussage erleichtert die Beurteilung sprunghafter Aussagen während die systematische Gliederung der Handlungssequenzen die Beurteilung der Handlungslogik und deliktspezifischer Verläufe erleichtert.
Selbstverständlich können in komplizierteren Sachlagen auch mehrere Methoden angewendet werden. .
Vergleichende Aussagenanalyse
Man kann unterschiedliche Aussagen zu einem Sachverhalt von einer Person oder von unterschiedlichen Personen (Beschuldigter, Opferzeugin, Zeugen) betrachten.
Aussage Aussageperson Zeitpunkt
Sachverhalt Art
Elementaraussage EA1, ... An
P1, ... Pn t1,
...tn S1
, .... Sn
W F ?
Molekularaussage MA1, ... An
P1, ... Pn t1,
...tn S1
, .... Sn
W F ?
Handlungseinheit HA1, ... An
P1, ... Pn t1,
...tn S1
, .... Sn
W F ?
Kerngeschehen KA1, ...
An P1, ... Pn
t1, ...tn S1
,
.... Sn W F ?
Randgeschehen RA1, ...
An P1, ... Pn
t1, ...tn S1
,
.... Sn W F ?
Gesamtaussage GA1, ...
An P1, ... Pn
t1, ...tn S1
,
.... Sn W F ?
Formale Vergleichsmoeglichkeiten
von Aussagen, ihren Elementen und Varianten
Vergleicht man "Aussagen", so ist als erstes genauer anzugeben, welche
Aussagenvarianten miteinander verglichen werden sollen:
- Elementar- oder Atomare Aussage (AA), kleinstmögliche Aussage der Form P(X) (lies: P von X).
- Molekulare Aussage (MA), aus atomaren Aussagen zusammengesetzt.
- Handlungseinheit (HA), die aus gewöhnlich aus mehreren molekularen oder atomaren Aussagen besteht.
- Erlebnisaussage (EA), das meist aus mehreren Handlungseinheiten besteht, aber auch nur eine Handlungseinheit beschreibt..
- erste Gesamtaussage (1GA), die oft mehrere Erlebnisse einbezieht aber auch nur aus einem bestehen kann..
- zweite Gesamtaussage (2GA), zu einem späteren Zeitpunkt.
- x-te Gesamtaussage (xGA), zu einem späteren Zeitpunkt.
Am sinnvollsten erscheinen - z.B. bei der Konstanzprüfung -
Vergleiche von Handlungseinheiten, z.B. bei der ersten und der zweiten
Gesamtaussage. Welche Handlungseinheiten kommen in der einen, aber nicht
in der anderen und umgekehrt vor? Und wie unterscheiden sich die thematisch
gleichen Handlungseinheiten von einander (molekular und atomar)? Welche
Gründe gibt es für die Unterschiede und was bedeuten sie für
die aussagepsychologische Beurteilung und Bewertung?
_
Strukturvergleiche (nach
Quelle)
|
|
|
|
|
|
| Struktur der Aussage | ||||
| Merkmalsanalyse | ||||
| Handlungssequenz-Analyse | ||||
| Konstanzanalyse | ||||
| Anzahl Elementar-Sachverhalte | ||||
| ... ... ... |
Der Druck der ErmittlerInnen, Aussagen zu gewinnen
Fast alle ErmittlerInnen, VernehmerInnen und AussagepsychologInnen stehen
unter einem großen Aussageproduktionsdruck. Wenn nicht genügend
Aussagen aus dem Zeugen herausgeholt werden können, dann gibt es keine
Anzeige, keine Ermittlungen, keine Anklage, keine Verurteilung. Natürlich
kenne ich diesen Druck selbst, weil ich ihn selbst mehr als mir lieb war,
in meiner Sachverständigentätigkeit erlebt habe. Dieser Druck,
Aussagen hervorbringen zu müssen, ist eine vielfältige Fehlerquelle
von Vernehmungen.
Ein gutes Indiz für diesen Druck ist die Anzahl der Fragen,
die gestellt werden. Realerlebnis-begründete Aussagen zeichnen sich
nämlich dadurch aus, daß in der freien Erzählung viele
und detaillierte Aussagen in etwas sprunghafter und ungeordneter Reihenfolge
vom Zeugen hervorgebracht werden. Dieses wichtige Merkmal und Realkennzeichen
Nr. 2 fehlt in aller Regel in Aussagen, die durch fremde Einflüsse
und nicht wirklich erlebnisbegründet fundiert sind. Machen wir uns
als erstes klar:
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen.
Und genauso ist es natürlich mit wirklichen Erlebnissen. Wenn einer was erlebt hat, dann kann er was erzählen. Das hat schon der Landgerichtspräsident Leonhardt 1934 - 100 Jahre nachdem Mittermaier die Grundzüge einer - auch heute noch weitgehend gültigen - kunstgerechten Vernehmung darlegte - sehr klar und deutlich beschrieben (nach Undeutsch 1967, S. 126):
„Ist ein Vorgang ... künstlich geschaffen, so ist er auf einen bestimmten, durch den Prozeß gegebenen Zweck zugeschnitten und weist in seinen Bestandteilen normalerweise nur das auf, was jenem Zweck dient; er entbehrt allem Beiwerks und namentlich auch individuelle Einzelheiten und Eigentümlichkeiten, wie sie mehr oder weniger jedem erlebten Vorgang eigen sind; das von ihm gegebene Bild ist ohne Leben, ein totes Schema von Vorgängen der betreffenden Art."
Wirkliche Erlebnisse können also im Prinzip detailreich berichtet werden. Für die aussagepsychologische Glaubhaftigkeit ist daher der frei produzierte Detailreichtum eines Erlebnisberichtes schon ein wichtiges Kriterium. Liegen nicht genügend Aussagen vor, ist eine aussagepsychologische Begutachtung nicht möglich, was häufig, vor allem bei kleineren Kindern der Fall ist und von allen Aufklärungsinteressierten meist sehr bedauert wird, weil dadurch möglicherweise eine KinderschänderIn einer gerechten Verurteilung entgeht. Und genau das ist häufig der Grund, weshalb die Vernehmerinnen so viele Fragen stellen. Doch wer viele Fragen stellt, begibt sich aber auf gefährliches Gelände, nämlich in die Gefahr, durch seine Fragen selbst herzustellen, was erst ermittelt werden soll, vor allem dann, wenn viele Suggestivfragen gestellt werden.
Die Bedeutung der Erstaussage
Undeutsch zu Bedeutung einer richtigen Erstbefragung (1967, S. 112):
„2. Erstbefragung
Der ersten Befragung wird von einigen Autoren eine außerordentlich große Bedeutung für die Ausformung der Aussage beigemessen. So schreibt Stern:
"Von den ersten Vernehmungen hängt also geradezu die ganze Zukunft des Prozesses ab: In ihnen wird eigentlich fast immer der Sachverhalt endgültig geklärt oder endgültig verschleiert" (1926,47).
Es werden in einer fehlerhaften, insbesondere in einer suggestiven Befragung große Gefahren für die Richtigkeit der auf diese Weise erzielten Aussagen erblickt."
Zum Thema Statistik der kindlichen Zeugen und Opfer, Probleme der Aussagegewinnung und Videotechnologie klicken Sie bitte hier. Zur Problematik des manchmal jahrelangen Verfahrens klicken Sie bitte hier.
Die Aufgabe der AussagepsychologInnen nach dem BGH
Der Bundesgerichtshof hat uns mit seinem Urteil vom 30.7.1999 klipp und klar gesagt, was wir AussagepsychologInnen zu tun haben:
- die Realkennzeichen erheben;
- die Bedeutung der Realkennzeichen prüfen (hypothesengeleitetes Vorgehen, z.B. fremde Einflüsse untersuchen und prüfen). Daraus folgt natürlich
- daß AussagepsychologInnen als Grundmaterial Aussagen brauchen, sonst können sie nicht gutachten, also: Aussagen gewinnen
- Es sollte sich von selbst verstehen, daß die Aussagen korrekt und zuverlässig erhoben werden müssen. Leider hat der Bundesgerichtshof noch nichts darüber gesagt, wie Aussagen zu gewinnen sind und welche Methoden hierbei strittig, verboten (Suggestivfragen?) oder nur unter besonderen Vorkehrungen und Kontrollen statthaft sind. Es ist zu hoffen, ja eigentlich zu fordern, dass der Bundesgerichtshof in absehbarer Zeit hierzu Richtlinien entwickeln wird.
BGH-Methodische Leitlinien zum Vorgehen bei aussagepsychologischen Gutachten
- Urteil des Bundesgerichtshofes
(1) Wissenschaftliche Anforderungen an aussagepsychologische Begutachtungen (Glaubhaftigkeitsgutachten).
BGH, Urt. vom 30. Juli 1999 - I StR 618/98 - LG Ansbach (StPO § 244 Abs. 4 Satz 2 ). Hieraus:
- "Begutachtung
...
a) Das methodische Grundprinzip besteht darin, einen zu überprüfenden Sachverhalt (hier: Glaubhafligkeit der spezifischen Aussage) so lange zu negieren, bis diese Negation mit den gesammelten Fakten nicht mehr vereinbar ist. Der Sachverständige nimmt daher bei der Begutachtung zunächst an, die Aussage sei unwahr (sog. Nullhypothese). Zur Prüfung dieser Annahme hat er weitere Hypothesen zu bilden. Ergibt seine Prüfstrategie, daß die Unwahrhypothese mit den erhobenen Fakten nicht mehr in Ubereinstimmung stehen kann, so wird sie verworfen, und es gilt dann die Alternativhypothese, daß es sich um eine wahre Aussage handelt. Die Bildung relevanter. Hypothesen ist daher von ausschlaggebender Bedeutung für Inhalt und (methodischen) Ablauf einer Glaubhafligkeitsbegutachtung. Sie stellt nach wissenschaftlichen Prinzipien einen wesentlichen, unerläßlichen Teil des Begutachtungsprozesses dar (Gutachten Prof Dr. Fiedler und Prof Dr. Steller; Eisenberg, Beweisrecht der StPO 3. Aufl. Rdn. 1863; Greuel/Offe/Fabian/Wetzels/Fabian/Offe/Stadler, Glaubhaftigkeit der Zeugenaussage S. 48 ff; StellerNolbert in Steller/Volbert, Psychologie im Strafverfahren S. 12, 23; Deckers NJW 1999, 1365, 1370; Greuel Praxis der Rechtspsychologie 1997, 154, 161; Köhnken MschrKrim 1997, 290, 293 ff; allgemein Westhoff/Kluck, Psychologische Gutachten schreiben und beurteilen S. 39 ff)."
(2) Der BGH zu Suggestion und Realkennzeichen
Aus dem Urteil des Bundesgerichtshof vom 30.7.1999 betreffend StPO § 244 Abs. 4 Satz 2 "Wissenschaftliche Anforderungen an aussagepsychologische Begutachtungen (Glaubhaftigkeitsbegutachtungen)", hier ein Auszug zur Bedeutung von Suggestionen auf die Realkennzeichen:
"Darüber hinaus ist stets zu beachten, daß die Realkennzeichen ungeeignet sind, zur Unterscheidung zwischen einer wahren und einer suggerierten Aussage beizutragen. Denn bei durch Suggestion verursachten Angaben bestehen die bereits dargelegten Gründe nicht, die eine unterschiedliche Qualität zwischen wahren und bewußt unwahren Aussagen verursachen können, da die aussagende Person sich weder als besonders glaubwürdig darstellen noch sich auf von ihr erdachte Umstände konzentrieren muß. Beispielsweise wird ein Kind seine Angaben, die objektiv nicht zutreffen, weil es sie unbewußt auf die Erwartungen des vernehmenden Erwachsenen ausgerichtet hat, subjektiv für wahr halten. Dementsprechend gibt es keine empirischen Belege dafür, daß sich erlebnisbasierte und suggerierte Aussagen in ihrer Qualität unterscheiden."
Probleme der Methodik
und der Hypothesenprüfung
Die Aussagepsychologie
Die großen Hypothesen der Aussagepsychologie
- William Sterns Grundlagen-Hypothese: Die Möglichkeit, die Bedingungen für wahre und falsche Aussagen differenziert zu erforschen.
- Undeutsch Hypothese: Erlebnisbegründete Aussagen unterscheiden sich in ihren Merkmalen von erlogenen oder erfundenen Aussagen (von Steller 1989 eingeführt; > Spektrum-Lexikon Psychologie: Undeutsch-Hypothese)
- Trankells Struktur Hypothese: Wahr und falsche Aussagen unterscheiden sich durch ihre jweils gleich formale Struktur. Praktische Anwendung: Vergleichende strukturelle Aussagenanalyse (wahr, falsch).
- Trankells personenspezifische Hypothese: "Die Vorstellung, daß jeder Zeuge durch eine konstante und von der Umwelt unabhängige Glaubwürdigkeit gekennzeichnet sei, entbehrt somit in den allermeisten Fällen der Realitätsgrundlage. Allgemeine Urteile über die Glaubwürdigkeit einer Person können daher außerordentlich gefährlich sein, wenn sie zur Grundlage genommen werden für Schlußfolgerungen auf die Aussagen dieser Person in anderen Situationen als denjenigen, auf denen diese Urteile basieren. Wie leicht einzusehen ist, fuhren diese Überlegungen doch nicht zu dem Ergebnis, daß die individuelle Beschaffenheit des Zeugen bei der psychologischen Untersuchung vernachlässigt werden könnte. Jede Aussage ist in gewissem Sinne Ausdruck der persönlichen Eigenart ihres Urhebers, und diese spielt in vielen Fällen eine entscheidende Rolle sowohl für die Form als auch für den Inhalt der Aussage. Jedes Individuum fungiert indessen in einem komplizierten Zusammenhang, in welchem das Verhältnis zu anderen Menschen und zu den entstandenen Situationen eine nicht minder bedeutsame Rolle für sein Verhalten spielt. Unser Verhalten ist nämlich in jedem Augenblick ein Produkt des Zusammenspiels zwischen den individuellen Verhaltensdispositionen und deren RealisationsmöglichkeitenI." (1971, S. 98). Praktische Anwendung: Vergleichende personenspezifische Aussagenanalyse (wahr, falsch).
- BGH-Hypothese: Authentische und suggierte Aussagen unterscheiden sich in ihren Merkmalen nicht, daher genügt die bloße Merkmalsanalyse nicht. Vielmehr bedarf es eines systematischen methodischen Ausschlusverfahrens der Hypothesen: "Die Bildung relevanter Hypothesen ist daher von ausschlaggebender Bedeutung für Inhalt und (methodischen) Ablauf einer Glaubhafligkeitsbegutachtung." (BGH 1999).
Voraussetzungen der Hypothesenprüfung
- Zunächst muss eine genügend umfangreiche (komplexe, differenzierte) Gesamtaussage vorliegen, damit überhaupt eine Merkmalsanalyse sog. "subjektiver Realerlebnisfundierung" vorgenommen werden kann. Subjektive Realerlebnisfundierung heißt hier nur, dass die ZeugIn glaubt, sie habe erlebt, was sie schildert. Den objektiven Tatsachengehalt stellt hierbei nicht die aussagepsychologische Sachverständige, sondern das Gericht fest - das natürlich weitere Beweisquellen (Spuren, andere Aussagen) einbezieht.
- Falls eine genügend umfangreiche Aussage vorliegt, müssen aber auch genügend subjektive Realerlebnismerkmale gefunden werden, damit eine Hypothesenprüfung sinnvoll erscheint.
- Wenn nicht genügend subjektive Realerlebnismerkmale vorliegen, ändert sich die Fragestellung: wie kann erklärt werden, dass die Aussage so wenige subjekte Realerlebnismerkmale zeigt? Hierbei ist auch wichtig zu verstehen, dass mangelnde subjektive Realerlebnismerkmale nicht zwingend auf Erfindung, Lüge oder Nichterleben hindeuten. Es kann auch z.B. an fehlender Ausdrucksfähigkeit liegen, die wiederum unterschiedliche und mehrere Gründe haben kann (kognitive Entwicklung, Unwissen, worauf es ankommt, was wichtig ist). Darauf weist auch Volbert (2008) in einem eigenen Abschnitt S. 15f hin:
- "Eine geringe Aussagequalität belegt nicht einen fehlenden Erlebnisbezug.
Bei den Glaubhaftigkeitsmerkmalen handelt es sich um Positivmerkmale, deren
Vorhandensein unter geeigneten Voraussetzungen auf den Erlebnisgehalt einer
Schilderung hinweist. Demgegenüber indiziert das Fehlen von Realkennzeichen
keineswegs zwingend eine [>16] nicht erlebnisbasierte Darstellung. Auch
bei realem Erlebnishintergrund kann eine geringe Aussagequalität vorliegen,
wobei diese sowohl auf individuelle Kompetenzen und persönlichkeitsspezifische
Dispositionen, auf die Aussagemotivation, aber auch auf situative Faktoren
zurückzuführen sein kann. So kann trotz realen Erlebnishintergrunds
eine geringe Aussagequalität produziert werden, wenn beim Zeugen eine
reduzierte Aussagekompetenz vorliegt, wenn er besonders ängstlich
oder psychisch nicht in der Lage ist, über das prinzipiell Erinnerte
zu berichten oder wenn keine ausreichende Aussagemotivation vorhanden ist.
Ferner sind situative Einflüsse zu berücksichtigen."
Die Grundaufgabe der Hypothesenprüfung
- Die Vielzahl möglicher Gründe und beeinflussende Faktoren für Aussageinhalte werden meist unterschätzt.
- Sie besteht darin, aus mehreren, mitunter gar vielen Möglichkeiten nach und nach immer mehr auszuschließen, bis - im Idealfalle - nur zwei übrig bleiben: die wahrscheinliche Hypothese und die Resthypothese (etwas anderes, bislang nicht berücksichtigte). Den vollständigen "Hypothesenraum", also alle Möglichkeiten, zu erfassen, ist im Allgemeinen nicht einfach.
- Hinzu kommt die Schwierigkeit, dass sich die verschiedenen Faktoren und Hypothesen auch gar nicht ausschließen müssen, sondern zusammen auftreten oder sich überlappen können. So können realerlebnisfundierte, Täuschungen und Irrtümer, Wunschphantasien und Erwartungen zusammenwirken. In aller Regel geht es daher meist nicht um ein Entweder-Oder (wahr oder falsch, wahrscheinlich oder unwahrscheinlich), sondern viele Faktoren können auf die einzelnen Aussagen einwirken und sie zu einem komplizierten Gebilde aus teilweise Richtigem und teilweise Falschem machen.
Moeglichkeiten und Methoden der
Hypothesenprüfung
Der folgende Ansatz ist nicht zwingend. Man kann auch andere wählen,
man muss nur sagen, welchen Ansatz man im jeweiligen Fall - aus diesen
oder jenen Gründen - gewählt hat. Das folgende Konzept geht von
vier Hauptmöglichkeiten aus: vollständig richtig, überwiegend
richtig, teilweise richtig, vollständig falsch mit den manchmal sinnvollen
Unterscheidungen mit Wissen und Absicht (Lüge) bzw. ohne
Wissen und Absicht (Täuschungen, Irrtum, Suggestionen). Ginge
man "fundamentalistisch" vor, müsste man alle theoretischen und möglichen
Hypothesen überprüfen, was natürlich in den meisten Fällen
weder zu leisten noch notwendig ist. Der theoretische Hypothesenraum kann
grob wie folgt bestimmt werden:
- 1.1 Im Haupt- und Kerngesehen vollständige richtige Erinnerung
und Aussage (selten)
- Eine vollständige Hypothesenprüfung wäre extrem zeit- und kostenaufwändig und manchmal mangels Methoden oder Daten im Einzelfall gar nicht möglich. Man wird daher im Regelfall nach dem praktischen juristischen Prinzip des "Anfangsverdachtes" vorgehen. Das heißt, man wird nur die Hypothesen prüfen, für die es Gründe ("Anknüpfungstatsachen", "Anfangsverdacht") gibt.
- Dies führt zum praktisch-relevanten "Hypothesenraum", in dem nun für und wider die einzelnen Hypothesen zu den einzelnen Aussagen argumentiert und die Entscheidung begründet wird. Meist ergeben sich die praktisch relevanten und sinnvollen Hypothesen aus den Aussagen, ihrer Entstehung und Entwicklung.
1.2 Im Haupt- und Kerngesehen überwiegend richtige Erinnerung und Aussage
1.3 Im Haupt- und Kerngesehen teilweise richtige bzw. falsche Erinnerung und Aussage
- 1.3.1 mit Wissen und Absicht (Lüge)
1.3.1.1 um es mit dem eigenen Wissen und Erfahrungen in Einklang zu bringen
1.3.1.2 um das Selbstbild, die eigene Rolle zu schonen (Peinlichkeiten, Scham)
1.3.1.3 um nach dem eigenen Verständnis glaubhafter zu wirken (guten Eindruck machen wollen, glätten, verdichten)
1.3.1.4 um Eindruck zu machen (aufbauschen, übertreiben, Aufmerksamkeit, Mittelpunkt)
1.3.1.5 aus Nachlässigkeit, Gedankenlosigkeit, Bequemlichkeit
1.3.1.6 aus Nachlässigkeit und falscher Einschätzung der Bedeutung ("wird schon nicht so wichtig sein")
1.3.1.7 aus aggressiv-destruktiven Motiven
1.3.1.x aus sonstigen bislang nicht aufgeführten Gründen
1.3.2 ohne Wissen und Absicht (Täuschungen, Irrtum, Suggestionen)
1.3.2.1 um es mit dem eigenen Wissen und Erfahrungen in Einklang zu bringen
1.3.2.2 um das Selbstbild, die eigene Rolle zu schonen (Peinlichkeiten, Scham)
1.3.2.3 um nach dem eigenen Verständnis glaubhafter zu wirken (guten Eindruck machen wollen, glätten, verdichten)
1.3.2.4 um Eindruck zu machen (aufbauschen, übertreiben, Aufmerksamkeit, Mittelpunkt)
1.3.2.5 aus Nachlässigkeit, Gedankenlosigkeit, Bequemlichkeit
1.3.2.6 aus Nachlässigkeit und falscher Einschätzung der Bedeutung ("wird schon nicht so wichtig sein")
1.3.2.7 aus aggressiv-destruktiven Motiven
1.3.2.8 aus suggestibler Empfänglichkeit
1.3.2.x aus sonstigen bislang nicht aufgeführten Gründen
- 1.4.1 mit Wissen und Absicht (Lüge)
1.4.1.1 um es mit dem eigenen Wissen und Erfahrungen in Einklang zu bringen
1.4.1.2 um das Selbstbild, die eigene Rolle zu schonen (Peinlichkeiten, Scham)
1.4.1.3 um nach dem eigenen Verständnis glaubhafter zu wirken (guten Eindruck machen wollen, glätten, verdichten)
1.4.1.4 um Eindruck zu machen (aufbauschen, übertreiben, Aufmerksamkeit, Mittelpunkt)
1.4.1.5 aus Nachlässigkeit, Gedankenlosigkeit, Bequemlichkeit
1.4.1.6 aus Nachlässigkeit und falscher Einschätzung der Bedeutung ("wird schon nicht so wichtig sein")
1.4.1.7 aus aggressiv-destruktiven Motiven
1.4.1.x aus sonstigen bislang nicht aufgeführten Gründen.
1.4.2 ohne Wissen und Absicht (Täuschungen, Irrtum, Suggestionen)
1.4.2.1 um es mit dem eigenen Wissen und Erfahrungen in Einklang zu bringen
1.4.2.2 um das Selbstbild, die eigene Rolle zu schonen (Peinlichkeiten, Scham)
1.4.2.3 um nach dem eigenen Verständnis glaubhafter zu wirken (guten Eindruck machen wollen, glätten, verdichten)
1.4.2.4 um besonderen Eindruck zu machen (aufbauschen, übertreiben, Aufmerksamkeit, Mittelpunkt)
1.4.2.5 aus Nachlässigkeit, Gedankenlosigkeit, Bequemlichkeit
1.4.2.6 aus Nachlässigkeit und falscher Einschätzung der Bedeutung ("wird schon nicht so wichtig sein")
1.4.2.7 aus aggressiv-destruktiven Motiven
1.4.2.8 aus suggestibler Empfänglichkeit
1.4.2.x aus sonstigen bislang nicht aufgeführten Gründen
- 1.5.1 mit Wissen und Absicht (Lüge)
1.5.2 ohne Wissen und Absicht durch Suggestion (> z.B. Fall Piaget)
1.5.3 ohne Wissen und Absicht (psychische Störung, z.B. Wahnerleben, Pseudologie)
Fachliche Ausfuehrungen zur Hypothesenprüfung bei aussagepsychologischen Fragestellungen
Volbert führt 2009 in "Glaubhaftigkeitsbegutachtung: Wie man die aussagepsychologische Methodik verstehen und missverstehen kann", S. 52 aus:
- "Zusammenfassung
- absichtliche Falschdarstellung (Lügenhypothese)
- eine subjektiv für wahr gehaltene, auf einer vermeintlichen „Erinnerung" basierende Darstellung, deren Inhalt aber tatsächlich keine Entsprechung in einer vorausgegangenen Realität hat. Derartige Pseudoerinnerungen entwickeln sich in der Regel auf der Basis fremd- und/oder autosuggestiver Prozesse (Suggestionshypothese).
Es wird auf in verschiedenen Beiträgen in diesem Heft geübte Kritik eingegangen, die die aussagepsychologische Methodik auf die Merkmalsorientierte Inhaltsanalyse reduziert. Der Gesamtprozess der aussagepsychologischen Begutachtung besteht aber in der systematischen Generierung und Prüfung von Voraussetzungen der Gegenhypothesen zur Wahrannahme.
In der Regel geht es um die Abklärung von zwei Gegenhypothesen zur Wahrannahme:
- "Zusammenfassung
Der diagnostische Wert der merkmalsorientierten Inhaltsanalyse für die Beurteilung der Glaubhaftigkeit von Aussagen ist prinzipiell unbestritten, theoretische Erklärungen und empirische Nachweise der Validität der Merkmale erstrecken sich jedoch im Wesentlichen auf Differenzierungen zwischen wahren und erfundenen Darstellungen. Unterschiede zwischen erlebnisbasierten und suggerierten Aussagen sind demgegenüber theoretisch nicht anzunehmen und sind auch empirisch nicht nachgewiesen worden. Wahre Aussagen weisen zudem nicht immer eine hohe Aussagequalität auf. Es wird argumentiert, dass die Merkmalsorientierte Inhaltsanalyse aus diesen Gründen weniger eine Methode zur Substantiierung des Wahrheitsgehalts, sondern vor allem eine Methode zur Falsifikation der Lügenhypothese darstellt. Der Gesamtprozess der aussagepsychologischen Begutachtung besteht in der systematischen Generierung und Prüfung von Voraussetzungen der Gegenhypothesen zur Wahrannahme. Der Merkmalsorientierten Inhaltsanalysen kommt dabei nur in einem Teil der Fälle eine zentrale Rolle zu."
Aussage-, Wahrnehmungs-, Gedächtnis- und Kommunikationspsychologie
Das folgende Schema präsentiert eine Mikroanalyse einer Aussage.
Bei genauer Betrachtung lassen sich viele, hier 12, Stationen einer
Aussageentstehung benennen und nachvollziehen. Am Anfang steht die Wahrnehmung.
Was von ihr erfasst wird, regelt die 2. Station aus der die dritte Station,
die Repräsentation im Bewusstsein, bei Aufnahme hervorgeht. Hier können
bereits einige, mitunter wichtige Teile verloren gegangen sein, so dass
diese in der 4. Station, im Gedächtnis, gar nicht abgespeichert oder
gemerkt werden. Damit können die nicht abgespeicherten Teile später
auch nicht erinnert werden. Die 5. Station repräsentiert die Aufbewahrungsfunktion
im Gedächtnis. Hier ist unklar, ob es überhaupt eine 1:1 Speicherung,
also ein statisches, konservierendes Gedächtnis gibt oder ob die aufbewahrten
Inhalte nicht dynamisch verwaltet werden und sich je nach Einflüssen
verändern können. Jeder Aufruf des Gedächtnisinhaltes findet
in der Regel in einem neuen Kontext, in einer neuen Situation in einer
spezifischen Interessenlage statt. Es werden u.U. unterschiedliche Aspekte
aktiviert und zu anderen Gedächtnis- oder Bewusstseinsinhalten in
Beziehung gesetzt. Betrachtet man einen Gedächtnisinhalt als
Netz von Merkmalsknoten und Verbindungen, so können sowohl spezielle
Merkmalsknoten als auch spezielle Verbindungen durch Aufruf und Dauer der
Aufmerksamkeitszuwendung verstärkt oder geschwächt werden.
Graphisch kann dies als allgemeines und integratives
Gedächtnismodell auf mehrerlei Weise illustriert werden. Merkmalsknoten
oder Verbindungen, die an Wichtigkeit gewinnen, werden dunkler oder / und
dicker (größer), Merkmalsknoten oder Verbindungen, die an Wichtigkeit
verlieren, werden heller oder / und dünner (kleiner). Geschwächte
Verbindungen kann man als erschwerten Zugriff interpretieren. Es können
neue Merkmalsknoten (Verfälschungen) hinzukommen oder alte verschwinden
(Vergessen).
Die 6. Station beschreibt die Erinnerung, die in
der 7. Station im Bewusstsein repräsentiert wird, wobei hier durch
Abwehr- und Neutralisationsmechanismen Teile verloren gehen oder verfälscht
werden können. In der 8. Station wird beurteilt, ob die Erinnerung
so für wahr gehalten wird oder zu verändern (Entstellen) ist.
Die Verarbeitung der Erinnerung beschreibt die 9. Station mit Denken, Vorstellen,
Schlußfolgern, Fantasietätigkeit. Die 10. Station erfasst die
sprachliche Gestaltung der Erinnerung, wofür 11. Verstehen von Worten,
Sätzen und ihrer Bedeutungen erforderlich ist bevor es schließlich
12. zum sprachlichen Ausdruck kommt.
Sobald man sich die Mikroanalyse einer Aussage vergegenwärtigt,
wird klar, dass eine Aussage, genau betrachtet, ein kompliziertes und schwieriges
Gebilde ist, das an vielen Stellen problematisch sein kann. Dieses Wissen
der (Aussage-) PsychologInnen sollte vor leichtfertigen Beurteilungen und
Bewertungen schützen. Man kann aber auch in eine übertriebene
wissenschaftliche Skepsis verfallen und sich gar nichts mehr mit praktischer
Sicherheit beurteilen und bewerten trauen. Das ist das andere Extrem.
Erklaerungsmodelle
für Erinnerungsverluste
Im wesentlichen denken wir uns hier zwei Funktionen: die Codierung
und den Zugriff auf Gedächtnisinhalte. Für eine Codierung für
Gedächtnisinhalte stellt sich die - derzeit nicht beantwortbare -
Frage, wie sich dieser Code bildet, erhält, was er zu seiner Erhaltung
braucht, wie und auf welche Weise er sich verändern und (teilweise)
zerfallen oder sich auflösen kann. Gedächtnisinhalte können
daher im Wesentlichen auf zwei Weisen verlustig gedacht werden: (1) der
Code verblasst, lässt nach, zerfällt, verändert sich. (2)
Der Zugriff ist gestört, behindert, gelingt nicht oder nur unzulänglich
oder teilweise.
Motive oder Gruende für falsche
Erinnerungen
In der folgenden Liste gibt es Überlappungen und Mehrfachmöglichkeiten:
- Fehlende oder nicht genügend entwickelte kognitive Strukturen für die Erfassung der Sachverhalte
- Das Bedürfnis nach Verständnis und Erklärungen fügt den Sachverhalt in das vorhandene (unzulängliche) kognitive System ein
- Der Sachverhalt wurde gar nicht abgespeichert (gemerkt)
- Der Sachverhalt wurde verfälscht abgespeichert (gemerkt)
- Der Wunsch einen guten Eindruck zu machen
- Der Wunsch einen bestimmten Eindruck zu machen
- Der Zugriff zum Gedächtnisinhalt der Erinnerung ist gestört
- Durch mehrfache und unterschiedliche Verarbeitung verändert
- ...
Grundlegende Gedaechtnismodelle
und Typen
In Ausarbeitung. Stichworte:
- Grundmodell I: Statisches 1:1 Abspeicherungsmodell: Der Gedächtnisinhalt wird als unverändert konserviert angenommen. Nichts geht verloren (> Penfield)
- Grundmodell II: Dynamisches Abspeicherungsmodell: der Gedächtnisinhalt kann sich im Laufe der Zeit verändern (derzeit von den meisten GedächtnisforscherInnen vertretene Hypothese)
- Ultrakurzzeitgedächtnis
- Kurzzeitgedächtnis
- Langzeitgedächtnis
- Semantisches Gedächtnis
- Episodisches Gedächtnis
- Prozedurales Gedächtnis
- Autobiographisches Gedächtnis.
Entwicklungspsychologie
der Aussagetuechtigkeit
Im wesentlichen folgt die Aussagetüchtigkeit der Denk- und Sprachentwicklung.
Die Entwicklung von Aussagefähigkeiten nach Volbert (2005)
Die Fähigkeit Angaben zum Vergangen zu machen bilde sich zwischen
2 und 3 Jahren aus (S. 243). Mit 3 bis 3 1/2 Jahren seien Kinder meist
erstmals in der Lage, eine zusammenhängede Darstellung eines Ereignisses
zu geben (S.244). Mit zunehmendem Alter steige die Produktivität
der Informationen. Einfache Skripts alltäglicher Vorgänge Anfang
des 4. Lebensjahres (S. 244).
Zeitlichkeit und Zeitbezüge nach Reimann (2005)
Sie setzt auf der Wahrnehmungsseite den Objektbegriff voraus, der sich
nach Piaget nach 18 Monaten ausbildet. Objektkonstanz bedeutet: die Dinge
sind auch da, wenn ich nicht hinauschaue oder mit ihnen hantiere. Für
Befragungen muss die sprachliche Ausdrucksfähigkeit grundausgebildet
sein. Das ist etwa mit drei Jahren der Fall. Nach Fritzley & Lee (2003)
antworteten 2jährige auf (suggestive) Ja/Nein-Fragen meist mit ja,
Kinder zwischen 4 und 5 auf unverständliche Fragen mit Nein (S. 258f).
Zwischen 4;0 und 4;6 Jahren kann das Kind mit Sprechzeit (hier und jetzt),
Ereigniszeit und Referenzzeit Ab etwa 2,6 Jahren werden nach Weist (1989)
Temporaladverbien [W]
und Adverbialsätze [W]
verwendet (S., 261). Der Erzählstil der Hauptbezugsperson (Mütter
22.6 Stunden; Väter 2.4 Stunden pro Woche; S. 262). Viele Beispiele
S. 264-268 und Einordnung in Kategorien: Zeitbezug als Wiederbegegnung
mit einem Objekt, sponatne Erinnerung; Umgebungsgeräusche; Wiederkehr
einer Handlung; Assoziationen).
Die 12 'Verbote' (‘Hauptsünden’)
in der Vernehmung (Exploration > Explorationsfehler)
Siehe auch §
136a StPO: verbotene Vernehmungsmethoden. > Zur Vernehmung
von geistig Behinderten,
- Aussagehemmende Faktoren zulassen (hemmende Anwesende, Störungen, Unterbrechungen, Ablenkungen)
- Sachverhalte, die erst ermittelt werden sollen, vorgeben
- Suggestivfragen jeglicher Art stellen
- Fragewiederholungen („insistieren"), die verunsichern, weil sie beim Zeugen den Eindruck erwecken, man akzeptiere seine Einlassung nicht
- Wertende sprachliche Kommentare (das gibt es doch gar nicht, das kann doch nicht sein, in schärfster Form, das heftige Bestreiten), die dem Kind den Weg weisen, was erwünscht und unerwünscht ist
- Wertendes Ausdrucksverhalten (Kopfschütteln, nicken, grimassieren, Augenbrauen hoch-ziehen, Augen verdrehen, entwertende Gesten wie z.B. wegwerfende Handbewegung usw.)
- Unkontrollierte Reaktionen (Hm, aha, soso, na so was, lachen, grimmig schauen, ...)
- Einseitiges - nicht zu allen in Frage kommenden Hypothesen - vernehmen (explorieren)
- Wichtige Sachverhalte nicht gründlich genug erforschen.
- Fremde Einflüsse nicht genügend erforschen und erheben
- Unzureichende Dokumentation (an besten sachverständige Videovernehmung)
- Gebrauch einer für die ZeugIn fremden oder gar unverständlichen Sprache (Fremdworte, mißverständliche oder nicht zeugengemäße Worte u. Beschreibungen).
Luegendetektion
"Forscher entwickeln Lügendetektor mit 70 Prozent Trefferquote. Forscher haben einen neuen Lügen-Detektor entwickelt, der eine Erfolgsquote von 70-80 Prozent erreicht. Damit übertrifft der Ganz-Körper-Detektor die bisherigen Polygraphen, die lediglich in 55 Prozent der Fälle richtig deuten, ob eine Person die Wahrheit sagt. Die neue Treffsicherheit soll das Gerät auch im bisher skeptischen Europa etablieren. " ..." [DWN 6.1.15]
Literatur
Beachten Sie bitte auch die Literatur in den Querverweisen.
- Allgemeine Methodologie und Wissenschaftstheorie
- Allgemeine Kriminologie und Forensische Psychologie
- Aussagepsychologie, Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit
- a) Gedächtnis, Erinnerung & Quellenverifikation: Irrtum, Induktion, Abwehr, Lüge, Suggestion.
- b) Spezielle Aussage- und Glaubwürdigkeitspsychologie
- c) Spezialproblem Zeitschätzungen und zeitliche Zuordnungen
- d) Diagnostische Probleme (Puppen, Zeichnungen)
- Entwicklungspsychologie
- Kinder- und Jugendsexualität
- Sexuell Abweichendes Verhalten
- Homosexualität
- Pädophilie und Pädophile
- Sexualität und Sexueller Mißbrauch in Kirche, Sekten, Religion
- Sexueller Mißbrauch & Vergewaltigung Mißbrauch des Mißbrauchs
- Querverweis: Literaturliste in: Suggestion und Suggestivfragen ...
- Querverweis: Hörigkeit und Abhängigkeit
- Querverweis: Pathologische Bindungsbeziehungen
- Querverweis: Literatur Gewissenstypologie, Abwehrmechnismen und Straftäterbehandlung
Allgemeine Methodologie und Wissenschaftstheorie
- Döhring, E. (1964). Die Erforschung des Sachverhalts im Prozeß. Berlin: Duncker & Humblot.
- Hilgendorf, E. (1993). Der Wahrheitsbegriff im Strafrecht am Beispiel der strafrechtlichen Aussagetheorien (§ 153 ff. StGB). Goltdammer's Archiv für Strafrecht, 547-559.
- Kamlah, W., Lorenzen, P. (1967). Logische Propädeutik. Vorschule des vernünftigen Redens. Mannheim: Bibliographisches Institut.
Allgemeine Kriminologie, Kriminalistik und Forensische Psychologie
- Dechene, H. C. (1975). Verwahrlosung und Delinquenz. Profil einer Kriminalpsychologie. München: Fink (UTB)
- Dettenborn, H.; Fröhlich, H.-H.; Szewczyk, H. (1989). Forensische Psychologie. Berlin: VEB Verlag der Wissenschaften.
- Douglas, J. E.; Burgess, A. W.; Burgess, A. G. & Ressler, R. K. (1992, Ed.). Crime Classification Manual. New York: Lexington.
- Füllgrabe, U. (1997). Kriminalpsychologie. Täter und Opfer im Spiel des Lebens. Frankfurt: Wötzel.
- Hartmann, K. (1970). Theoretische und empirische Beiträge zur Verwahrlosungsforschung. Berlin: Springer.
- Kube, Edwin / Störzer, Hans Udo / Brugger, Siegfried (1983) Wissenschaftliche Kriminalistik. BKA-Forschungsreihe Band 16-1
- Mittermaier, C.J.A. (1834). Die Lehre vom Beweise im deutschen Strafprozesse nach der Fortbildung durch Gerichtsgebrauch und deutsche Gesetzbücher in Vergleichung mit den Ansichten des englischen und französischen Strafverfahrens. Darmstadt: Heyer's Verlagsbuchhandlung.
- Quensel, S. (1964). Sozialpsychologische Aspekte der Kriminologie. Stuttgart: Enke.
- Schneider, H.-J. (1983, Hg.). Kriminalität und abweichendes Verhalten. 2 Bde. Weinheim: Beltz.
- Schmitz, H. Walter (1977) Tatortbesichtigung und Tathergang. BKA-Forschungsreihe Band 06
- Undeutsch, U. (1967, Hg.). Forensische Psychologie, Handbuch der Psychologie Bd. 11. Göttingen: Hogrefe.
- Wegener, H. (1981). Einführung in die forensische Psychologie. Damrstadt: Wiss. Buchgesellschaft.
- Witter, H. (1970). Grundriß der gerichtlichen Psychologie und Psychiatrie. Berlin: Springer.
Aussagepsychologie und Glaubwuerdigkeit
> Literaturliste Suggestion und Suggestibilität.
Juristische Perspektive - Kriminologie - Kripo
- Artkämper, Heiko (2012) Karsten Schilling: "Vernehmungen - Taktik, Psychologie, Recht" 2. Auflage 2012. Verlag: Deutsche Polizeiliteratur
- Banscherus, Jürgen (1977) Polizeiliche Vernehmung: Formen, Verhalten, Protokollierung. Eine empirische Untersuchung aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht. BKA For-schungsreihe 7. Wiesbaden / Hilden: Verlagsanstalt Deutsche Polizei GmbH.
- Bauer, Günther (1970). Aus Kapitel C 6.6, S. 346-353:Kinder und Jugendlich im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren und C 6.8, S. 355-356: Suggestivfragen. In: Moderne Verbrechensbekämpfung Bd.1: Kriminaltaktik, Aussage und Vernehmung, Meldewesen. Lübeck: Verlag für polizeiliches Fachschrifttum Schmidt-Römhild.
- Berresheim A, Capellmann (2013) Personen mit und ohne Aussagewiderstand. Taktische Kommunikation im Rahmen der Strukturierten Vernehmung. In: Kriminalistik 67 (2), 93 – 99.
- Boetticher, A. (2002). Anforderungen an Glaubhaftigkeitsgutachten nach der neuesten BGH-Rechtssprechung. In S. Barton (Hrsg.), Verfahrensgerechtigkeit und Zeugenbeweis (S. 55-65). Baden-Baden: Nomos.
- Boetticher, A. (2002). Das Urteil über die Einführung von Mindeststandards in aussagepsychologischen Gutachten und seine Wirkungen. Neue Juristische Wochenschrift [Sonderheft zur Vollendung des 65. Lebensjahres von Gerhard Schäfer], 8-18.
- Brockmann, Claudia & Chedor, Reinhard (1999) Vernehmung: Hilfen für den Praktiker. Verlag: Deutsche Polizeiliteratur.
- Bundesregierung (2014) Drucksache 18/1413. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Martina Renner, Wolfgang Gehrcke, Annette Groth, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. Ausbildung in und Nutzung der Reid-Methode durch deutsche Bundesbehörden. Im Internet abrufbar unter: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/014/1801413.pdf (letzter Aufruf am 18.08.2015)
- Fischer, Johann (1975) Die polizeiliche Vernehmung. BKA-Shriftenreihe.
- Geerds, Friedrich (1976). Vernehmungstechnik. Lübeck: Verlag für polizeiliches Fachschrifttum Schmidt-Römhild.
- Geipel, Andreas (2008) Handbuch der Beweiswürdigung. [1200 Seiten] ZAP-Verlag
- Gundlach, Rainer (1984) Die Vernehmung des Beschuldigten im Ermittlungsverfahren. Frankfurt: Lang.
- Habschick, Klaus (2012) Erfolgreich Vernehmen. Kompetenz in der Kommunikations-, Gesprächs- und Vernehmungspraxis. 3. A. Heidelberg: Kriminalistik. [GB]
- Werner Hausmann u.a. (1986) Kriminalistik: Die Vernehmung von Zeugen und Beschuldigten. 2. A. Berlin: Ministerium des Innern
- Hellwig, Albert (1951, 4.A.). Psychologie und Vernehmungstechnik bei Tatbestandsermittlungen. Stuttgart: Enke.
- Hermanutz, Max & Litzcke, Max (2009). Vernehmung in Theorie und Praxis. Wahrheit - Irrtum . Lüge. Stuttgart: Boorberg.
- Hermanutz, Max (2011).Polizeiliche Vernehmung und Glaubhaftigkeit: ein Trainingsleitfaden. Ausgabe 3., erw. Aufl. Stuttgart: Boorberg.
- Leonhardt, Curt (1930a) Psychologische Beweisführung in Ansehung existenzstreitiger Vorgänge. Arch. f. d. ges. Psychol. 1930, 75, 545—558 a.
- Leonhardt, Curt (1930b) Psychologische Beweisführung. DRiZ 1930, 22 ff. b.
- Leonhardt, Curt (1930c) Weitgehende Verwertung psychologischer Symptome in einem Eheurteil. Judicium 1930, 2. Jg., 344 ff. c.
- Leonhardt, Curt (1931a) Die Hilfe der psychologischen Beweisführung bei der Untersuchung von Sittlichkeitsdelikten. Zsdi. f. angew. Psychol. 1931, 39, 394—407 a.
- Leonhardt, Curt (1931b) Beiträge zur psychologischen Beweisführung in Ansehung existenzstreitiger Vorgänge. Arch. f. d. ges. Psychol. 1931, 78, 95—103 b.
- Leonhardt, Curt (1931c) Psychologische Beweisführung. Mschr. f. Kriminalpsychol. 1931, 22, 140—151 c.
- Leonhardt, Curt (1931d) Psychologische Beweisführung in Ansehung existenzstreitiger Vorgänge. Krimin. Mon.-Hefte 1931, 5, 145—149 d.
- Leonhardt, Curt (1931e) Psychologische Beweisführung. Arch. f. Krimin. 1931, 89, 203—207 e.
- Leonhardt, Curt (1931f) Das erdichtete Erlebnis in der eidlichen Zeugenaussage und die Aufdeckung des Meineidsverbrechens mit Hilfe der psychologischen Beweisführung, erläutert an einem methodisch behandelten Fall der Praxis. Zsch. f. d. ges. Strafrechts-Wiss. 1931, 51, 770 ff. f.
- Leonhardt, Curt (1931g) Die praktische Verwertbarkeit der psychologischen Beweisführung. Judicium 1931, 4. Jg., 73 ff. g.
- Leonhardt, Curt (1931h) Psychologische Beweisführung in Ansehung existenzstreitiger Vorgänge: Die Verwertung des Symptoms „Weinen“ für die Beweisführung. Judicium 1931, 3. Jg., 75 ff. h.
- Leonhardt, Curt (1931i) Psychologische Beweisführung in Ansehung existenzstreitiger Vorgänge: Die forensische Bedeutung des Lächelns und die Verwertung des Symptoms für die Beweisführung. Judicium 1931, 3. Jg., 205 ff. i.
- Leonhardt, Curt (1932) Vorschläge zu einer psychologischen Beweisführung in ihren Grundgedanken. Arch. f. d. ges. Psychol. 1932, 84, 283—305.
- Leonhardt, Curt (1933) Die erste Vernehmung des Beschuldigten und ihre Bedeutung für die Schuldfrage in Kriminalfällen bestrittener oder zweifelhafter Täterschaft. Krimin. Mon.-Hefte 1933, 7, 2Y1—221.
- Leonhardt, Curt (1934a) Psychologische Beweisführung in Ansehung existenzstreitiger Vorgänge. Zsch. f. angew. Psychol. 1934, 46, 229—245 a.
- Leonhardt, Curt (1934b) Systematischer Aufbau einer psychologischen Beweisführung in Ansehung existenz streitiger Vorgänge. Zsch. f. angew. Psychol. 1934, 46, 358—394 b.
- Leonhardt, Curt (1934c) Kritik der psychologischen Beweisführung. Msch. f. Krim. Psychol. 1934, 25, III 121 c.
- Leonhardt, Curt (1934d) Die Verwertung psychologischer Indizien bei Würdigung sich widersprechender Aussagen. Schweiz. Zsch. f. Strafr. 1934, 48. Jg., 96 ff. d,
- Leonhardt, Curt (1936) Methodisches Vorgehen zur Feststellung, ob ein angebliches in Existenz streitiges oder zweifelhaftes Erlebnis der Auskunftsperson in der Tat statt gefunden hat oder lediglich erdichtet ist. Zsch. f. angew. Psychol. 1936, 50, 183 bis 208.
- Leonhardt, Curt (1938a) Psychologische Indizien. Zsch. f. angew. Psychol 1938, 55, 324—333 a.
- Leonhardt, Curt (1938b) Haben Unschuldsbeteuerungen Beweiswert? Kriminalistik 1938, 124 ff. b.
- Leonhardt, Curt (1939a) Ein wichtiges Sdiulindiz. Arch. f. Krimin. 1939, 104, 214—224 a.
- Leonhardt, Curt (1939b) Ein wichtiges Schuldindiz. Arch. f. Kriminol 1939, 104, 214 ff. b.
- Leonhardt, Curt (1940a) Die forensische Bedeutung des Weinens und die Verwertung des Symptoms für die Beweisführung in Fällen existenzstreitiger Erlebnisse. Arch. ges. Psychol. 1940, 107, 35—70 a.
- Leonhardt, Curt (1940b) Die Verwertung psychologischer Symptome für die forensische Wahrheitserforschung in Fällen existenzstreitiger Erlebnisse. Msch. f. Kriminalbiol., 1940, 31, 86—99 b.
- Leonhardt, Curt (1941a) Ein bedeutungsvolles Symptom der Unschuld. Arch. f. Krimin. 1941, 108, 41—44 a.
- Leonhardt, Curt (1941b) Die Auswertung des Nachklangs der durch bedeutsame Erlebnisse ausgelösten Gefühle für die forensische Wahrheitsermittlung. Arch. f. d. ges. Psychol 1941, 109, 297—311b.
- Leonhardt, Curt (1941c) Ein bedeutungsvolles Symptom der Unschuld. Arch. f. Kriminol. 1941, 108, 41 ff. c.
- Lindner, Bernd (1988) Täuschungen in der Vernehmung des Beschuldigten. Ein Beitrag zur Auslegung des § 136a StPO. Dissertation JurFak Tübingen.
- Mittermaier, C.J.A. (1834). Die Lehre vom Beweise im deutschen Strafprozesse nach der Fortbildung durch Gerichtsgebrauch und deutsche Gesetzbücher in Vergleichung mit den Ansichten des englischen und französischen Strafverfahrens. Darmstadt: Heyer's Verlagsbuchhandlung. > Suggestivfragen.
- Prasch, Volker (2003) Die List in der Vernehmung und Befragung des Beschuldigten Zugleich ein Beitrag zur Auslegung des Täuschungsverbots des § 136a StPO. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde einer Hohen Rechtswissenschaftlichen Fa-kultät der Universität zu Köln.
- Rieß, Peter (1980) Die Vernehmung des Beschuldigten im Strafprozeß. JA 1980, 293-301.
- Schwindt, R (1989). Die polizeiliche Vernehmung. Kriminalistik, 43 (2), 89-92.
- Wille, Heinrich (2012) Aussage gegen Aussage. in sexuellen Missbrauchsverfahren. Defizitäre Angeklagtenrechte in Deutschland und Österreich und deren Korrekturmöglichkeiten. Berlin: Springer. [Diss. Univ Salzburg]
a) Gedaechtnis,
Erinnerung & Quellenverifikation: Irrtum, Induktion, Abwehr, Lüge,
Suggestion.
- Albert, D. & Stapf, K.-H. (1996, Hg.). Gedächtnis. Enzyklopädie der Psychologie C, II, Bd. 4. Göttingen: Hogrefe.
- Berger, Oliver (2005) Aspekte der Zeugenkompetenz und Validierung Der Kriterienorientierten Aussageanalyse von Jugendlichen mit Intelligenzminderung. Längsschnittliche Untersuchungen zur Gedächtnisleistung und Quellendifferenzierung sowie Analyse der aussageimmanenten Qualitätsmerkmale. Dissertation Philosophische Fakultät II Universität Regensburg.
- Egg, R., Sponsel, R. (1978). "Bagatelldelinquenz" und Techniken der Neutralisierung. Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 61, 1978, 1, 38-50 {Zusammenfassung Diplom-Arbeit über Abwehrmechanismen in der Kriminalität}
- Endres, J. (1998). Wie suggestibel ist dieses Kind? Überblick über bisherige experimentelle Arbeiten mit dem ‘Bonner Test für Aussagesuggestibilität’". Report Psychologie 23, 10, 816-827.
- Festinger, L. (dt. 1978, orig. 1957). Theorie der kognitiven Dissonanz. Bern: Huber.
- Freud, A. (dt. o. J., orig. 1936). Das Ich und die Abwehrmechanismen. München: Kindler.
- Füllgrabe, U. (1995). Irrtum und Lüge. Stuttgart: Boorberg.
- Hell, W.; Fiedler, K. & Gigerenzer, G. (1993, Hg.). Kognitive Täuschungen. Fehl-Leistungen und Mechanismen des Urteilens, Denkens und Erinnerns. Heidelberg: Spektrum.
- Kail, R. (1992, orig. 1989). Kinder als Zeugen vor Gericht, in: Gedächtnisentwicklung bei Kindern, 124-135. Heidelberg: Spektrum.
- Kail, R. (1992, orig. 1989). Das Gedächtnis geistig behinderter Kinder, in: Gedächtnisentwicklung bei Kindern, 110-123. Heidelberg: Spektrum.
- Kail, R. (1992). Gedächtnisentwicklung bei Kindern. Heidelberg: Spektrum.
- Köhnken, G. "Nachträgliche Informationen und die Erinnerung komplexer Sachverhalte - Empirische Befunde und theoretische Kontroversen", Psychologische Rundschau 1987, 38, 190-203.
- Köhnken, G. "Techniken zur Verbesserung der Erinnerungsleistung im Interview: Das Kognitive Interview", Praxis der Forensischen Psychologie", 2, 1992, 2, 85-91
- Kotre, John (dt. 1996, eng. 1995). Weisse Handschuhe. Wie das Gedächtnis Lebensgeschichten schreibt. München.
- Loftus, E. F. (1992). "Erinnerung und Wahrheit", Psychologie Heute 12, 25-27.
- Malpass, R. S. "Techniken zur Verbesserung der Gedächtnisleistung", in: Köhnken, G.; Sporer, S. L. (Hrsg.) "Identifizierung von Tatverdächtigen durch Augenzeugen", Stuttgart 1990, 135-156
- Ofshe, R. & Watters, E. (dt. 1996, orig. 1994). Die mißbrauchte Erinnerung. Von einer Therapie, die Väter zu Tätern macht. München: dtv.
- Schmid, Jeannette (1996) Lügen im Alltag - Zustandekommen und Bewertung kommunikativer Täuschungen. Münster: Lit.
- Shaw, Julia (2016) Das trügerische Gedächtnis. Wie unser Gehirn Erinnerungen fälscht. München: Hanser.
- Shaw, Julia & Porter, Stephen (2015) Constructing Rich False Memories of Committing Crime. Psychological Science, 1–11. PDF im Netz.
- Snyder, C.R.; Higgins, R.L. & Stucky R.J. (dt. 1986). Ausreden. Was unsere großen und kleinen Lügen wirklich bedeuten. Landsberg a.L.: mvg.
- Volbert, R. (1997). Suggestibilität kindlicher Zeugen. In: Steller, M. & Volbert, R. (1997, Hg.), 40-62.
- Yapko, M.D. (dt. 1996, orig. 1994). Fehldiagnose Sexueller Mißbrauch. München: Heyne.
b) Spezielle Aussage- und Glaubwürdigkeitspsychologie
- Arnold, K.-H. (1997). Was und wie beweisen psychologische Glaubwürdigkeitsgutachten. Praxis der Rechtspsychologie. Themenschwerpunkt Aussagepsychologie. 7 Jhg., 2, 170-186.
- Arntzen, Friedrich / Michaelis, Elisabeth (1970) Psychologie der Kindervernehmung. BKA-Reihe Polizei bzw. BKA-Schriftenreihe Band 36
- Arntzen, F. (3.A. 1993). "Psychologie der Zeugenaussage. System der Glaubwürdigkeitsmerkmale", 3. A. München: C. H. Beck.
- Arntzen, F. (2007)
- Arntzen, F. (2014)
- Bender, H.-U. (1987). "Merkmalskombinationen in Aussagen", Tübingen: J.C.B. Mohr.
- Bender, Rolf ; Nack, Armin & Treuer, Wolf-Dieter (20144) Tatsachenfeststellung vor Gericht. Glaubwürdigkeits- und Beweislehre. Vernehmungslehre. Bearbeitet von: Robert Häcker/Volker Schwarz/Wolf-Dieter Treuer. 4. Auflage. München: Beck. [420 Seiten]
- Bender, Rolf ; Nack, Armin & Treuer, Wolf-Dieter (20073) Tatsachenfeststellung vor Gericht. Glaubwürdigkeits- und Beweislehre. Vernehmungslehre. 3. Auflage. München: Beck. [358 Seiten]
- Bender, R.; Nack, A. (19952). "Tatsachenfeststellung vor Gericht. Bd. 1 Glaubwürdigkeits- und Beweislehre", Bd. 2 Vernehmungslehre, 2. A. München: C.H. Beck. [296+292=588 Seiten]
- Bender, R.; Nack, A. & Röder, S. (1981). "Tatsachenfeststellung vor Gericht. Bd. 1 Glaubwürdigkeits- und Beweislehre", Bd. 2 Vernehmungslehre, 2. A. München: C.H. Beck. [241+198=439 Seiten]
- Clauß, M. (2005). Glaubhaftigkeitsbegutachtungen bei psychisch kranken Zeugen. In M. Clauß, M. Karle, M. Günter & G. Barth (Hrsg.), Sexuelle Entwicklung - sexuelle Gewalt. Grundlagen forensischer Begutachtung von Kindern und Jugendlichen (S. 88-114). Lengerich: Pabst.
- Deckers, Rüdiger & Köhnken, Günter (20142, Hrsg.) Die Erhebung und Bewertung von Zeugenaussagen im Strafprozess: Juristische, aussagepsychologische und psychiatrische Aspekte. Berlin: BWV. [GB]
- Deckers, Rüdiger ; Köhnken, Günter (2007, Hrsg.). Die Erhebung von Zeugenaussagen im Strafprozess : juristische, aussagepsychologische und psychiatrische Aspekte Berlin : Berliner Wiss.-Verl.
- Dettenborn, H.; Fröhlich, H.-H.; Szewczyk, H. (1989). "Die psychologische Begutachtung der Glaubwürdigkeit", in: "Forensische Psychologie", 289-333. Berlin: VEB Verlag der Wissenschaften.
- Fahrendholz, Lisa (2016) Aussagepsychologie und erzwungene Geständnisse : zur Diskriminationsfähigkeit der Merkmalsorientierten Inhaltsanalyse (CBCA) unter variierenden Vernehmungsbedingungen zur Diskriminationsfähigkeit der Merkmalsorientierten Inhaltsanalyse (CBCA) unter variierenden Vernehmungsbedingungern. [Masterarbeit Präsenzbestand 04PA10/CZ 9000.2016 F158]
- Fegert, J. (Hrsg.) (2001). Begutachtung sexuell missbrauchter Kinder. Fachliche Standards im juristischen Verfahren. Neuwied: Luchterhand.
- Fiedler, Klaus & Schmid, Jeannette (1998) Wahrheitsattribution: ein neuer theoretischer und methodischer Ansatz zur Lügenforschung. In (167-180) Spitznagerl, Albert (1998, Hrsg.) Geheimnis und Geheimhaltung. Göttingen: Hogrefe.
- Fiedler, Klaus & Schmid, Jeannette (1999) Gutachten über Methodik für Psychologische Glaubwürdigkeitsgutachten. [Themenheft BGH Gutachten Aussagepsychologie] In Praxis der Rechtspsychologie 9,2, 5-45. Mit Fragen- und Antwortkatalog des BGH, 43-45.
- Ganal, R. (1962). "Zur Problematik des Begriffes der Glaubwürdigkeit und seiner Beurteilung", in: "Jahrbuch für Jugendpsychiatrie und ihre Grenzgebiete", Hrsg. Villinger & Stutte, Bd. III, S.94-99. Bern: Huber.
- Greuel, L.; Fabian, T. & Stadler, M. (1997, Hg.) Psychologie der Zeugenaussage. Ergebnisse rechtspsychologischer Forschung {der Tagung der DGPs 1995 in Bremen}. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Greuel, L. (1997). Glaubwürdigkeit - Zur pychologischen Differenzierung eines umgangssprachlichen Konstrukts. Praxis der Rechtspsychologie. Themenschwerpunkt Aussagepsychologie. 7 Jhg., 2, 154-170.
- Greuel, L., Offe, S„ Fabian, A., Wetzels, P, Fabian, T., Offe, H. & Stadler, M. (1998). Glaubhaftigkeit der Zeugenaussage. Theorie und Praxis der forensisch-psychologischen Begutachtung. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Greuel, Luise (2001). Wirklichkeit - Erinnerung - Aussage. Weinheim: BeltzPVU.
- Heinrich, Christina U. (1995) Ausdruck und Eindruck. Die Zuschreibung von Glaubwürdigkeit anhand visueller und vokaler Informationen. Dissertatation Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaften Universität Bielefeld. [UB: H00 97 U/992]
- Hinckeldey, Sabine von & Fischer, Gottfried (2002). Kapitel 8 Psychotraumatologie der Zeugenaussage und Begutachtung vor Gericht in: Psychotraumatologie der Gedächtnisleistung. München: Reinhardt UTB
- Jansen, Gabriele (2004, 2012). Zeuge und Aussagepsychologie. Praxis der Strafverteidigung. 2., neu bearb. und erw. Aufl. 2012. Heidelberg: Müller. [GB]
- Köhnken, G. (1990). "Glaubwürdigkeit. Untersuchungen zu einem psychologischen Konstrukt", München: Psychologie Verlags Union.
- Köhnken, G. & Wegener, H. (1982) Zur Glaubwürdigkeit von Zeugenaussagen: Experimentelle Überprüfung ausgewählter Glaubwürdigkeitskriterien. Z. allgem. angew. Psychol, XXIX.
- Köhnken, G. (1999). Die Aussagefähigkeit kindlicher Zeugen. In R. Lempp, G. Schütze & G. Köhnken (Hrsg.), Forensische Psychiatrie und Psychologie des Kindes- und Jugendalters. Darmstadt: Steinkopff, S. 354-362.
- Köhnken, G. (2006) § 62 Glaubwürdigkeitsbegutachtung. In Widmaier, Münchener Anwaltshandbuch Strafverteidigung, 1. Auflage 2006 Rn 1 - 148, beck-online.
- Krahe, B.; Kundrotas, S. (1992). "Glaubwürdigkeitsbeurteilung bei Vergewaltigungsanzeigen: Ein aussageanalytisches Feldexperiment", Zeitschrift für experimentelle und angewandte Psychologie 39(4), 598-620.
- Lafrenz, B. (2006). Wahrheit und Lüge bei Zeugenaussagen: Trennschärfeanalyse der so genannten Realkennzeichen. Saarbrücken: Müller.
- Lafrenz, Bianca (2006). Wahrheit und Lüge bei Zeugenaussagen : Trennschärfeanalyse der so genannten Realkennzeichen. Saarbrücken: Müller, [Zugl.: Diplomarbeit]
- Lipmann, O. (1905). Reformvorschläge zur Zeugenvernehmung vom Standpunkt des Psychologen. Archiv für Kriminologie, .
- Lipmann, O. (1925). Grundriß der Psychologie für Juristen.
- Lipmann, O. (1933). Methoden der Aussagepsychologie. In: Abderhalten (1933, Hrsg.). Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden, Abteilung VI, Teil C/II, 967-1056.
- Loohs, S. (1996). Die Verwendung spezifischer Explorationsmethoden zur Befragung kindlicher Zeugen im Hinblick auf Gedächtnisleistung, Suggestibilität und das Weidererkennen von Gesichtern. Disseration Universität Regensburg.
- Maier, Barbara (2006). Glaubhaftigkeitsdiagnostik von Zeugenaussagen : eine diskriminanzanalytische Untersuchung. Saarbrücken: VDM-Verl. Müller.
- Marbe, Karl (1913) Grundzüge der forensischen Psychologie. München: Beck.
- Martens, Karin (1979, Hrsg.) Kindliche Kommunikation. Theoretische Perspektiven, empirische Analysen, methodologische Grundlagen. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Milne, Rebecca & Bill, Ray (dt. 2003) Psychologie der Vernehmung. Die Befragung von Tatverdächtigen, Zeugen und Opfern. Bern: Huber.
- Moll, A. (1927) Eine notwendige Kritik der forensischen Aussagepsychologie Sterns. Kriminalistische Monatshefte. Zeitschrift
- Nau, E. (1962). "Die Glaubwürdigkeitsbeurteilung kindlicher und jugendlicher Zeugen", in: Jahrbuch für Kinder- und Jugendpsychiatrie und ihre Grenzgebiete III, S.75-89, Bern: Huber.
- Nack, A. (1995). Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit. Kriminalistik, 49 (4), S. 257-262.
- Niehaus, S. (2001). Zur Anwendbarkeit inhaltlicher Glaubhaftigkeitsmerkmale bei Zeugenaussagen unterschiedlichen Wahrheitsgehaltes: eine Simulationsstudie mit kindlichen Verkehrsunfallopfern. Frankfurt/Main: Peter Lang.
- Offe, S.; Offe, H. (1994). "Anforderungen an die Begutachtung der Glaubwürdigkeit von Zeugenaussagen bei Verdacht des sexuellen Mißbrauchs". Praxis der Rechtspsychologie 4(1), 24-36.
- Offe, H, (2000). Anforderungen an die Begutachtung der Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen. Neue Juristische Wochenschrift, 13, 929-930.
- Offe, Heinz & Susanne (2008) Aussagekonstanz als Indikator für den Erlebnisbezug einer Aussage. Praxis der Rechtspsychologie, 18,1, 97-115.
- Prechtel,l Günter (2017) Die Bedeutung der Glaubwürdigkeit und des persönlichen Eindrucks für die Beweiswürdigung. ZJS 4/2017, 381-395. [Online]
- Regber, Anke (2007). Glaubhaftigkeit und Suggestibilität kindlicher Zeugenaussagen unter Einbeziehung entwicklungspsychologischer Aspekte. Frankfurt aM: Verl. für Polizeiwissenschaft, [Zugl.: Diplomarbeit]
- Offe, H. (2002, Hrsg.). Die Begutachtung der Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen. In (127-138) T. Fabian (2002, Hrsg.), Praxisfelder der Rechtspsychologie, Beiträge zur rechtspsychologischen Praxis. Münster: LIT.
- Offe, Heint & Offe, Susanne (2002) Die individuelle Vergleichsgrundlage für die Aussagebeurteilung. Praxis der Rechtspsychologie 10,2,2000, 37-54.
- Praxis der Rechtspsychologie. Organ der Sektion Rechtspsychologie im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. Eine hervorragende Zeitschrift mit sehr guter Dokumentation des rechtspsychologischen Geschehens, hier besonders:
- Themenheft Aussagepsychologie, 7. Jg., 2, 1997
- Themenheft BGH Gutachten Aussagepsychologie, 9. Jg., 2, 1999
- Themenheft Glaubhaftigkeitspsychologie, 10 Jg., 1, 2000 (Themenschwerpunkt)
- Themenheft Aussage - und Zeugenpsychologie 23,1, 2013
- Schade, B. (2000). Der Zeitraum von der Erstaussage bis zur Hauptverhandlung als psychologischer Prozeß. Folgerungen für die Glaubwürdigkeitsbegutachtung am Beispiel der Wormser Prozesse über sexuellen Kindesmißbrauch. Strafverteidiger, 20, 165-170.
- Schemm, K. v. & Köhnken, G. (2008). Voreinstellungen und das Testen sozialer Hypothesen im Interview. In (322-330) Volbert, R. & M. Steller (2008, Hrsg.), Handbuch der Rechtspsychologie. Göttingen: Hogrefe.
- Schemmel, Jonas & Volbert, Renate (2017) Gibt es eine personenspezifische Aussagequalität? - Die Konsistenz der Qualität von wahren und erfundenen Aussagen einer Person zu verschiedenen Ereignissen. Praxis der Rechtspsychologie 27,1,2017, 79-104.
- Schwind, Domenica (2007). Glaubhaftigkeit von Zeugen vor Gericht: Trennschärfe der Realkennzeichen anhand von aussagepsychologischen Gutachten.
- Schröer, N. (2003). Zur Handlungslogik polizeilichen Vernehmens. In J. Rei-chertz&N. Schröer. Hermeneutische Polizeiforschung. Opladen, S. 72. Hochschulschrift Zugl.: Diplomarbeit Saarbrücken: VDM-Müller
- Späth, W. (1969) Die Zuverlässigkeit der im ersten Zugriff erfolgten Aussage. Kriminalistik, 499-
- Steller, M.; Wellershaus, P.; Wolf, T. (1992). "Realkennzeichen in Kinderaussagen. Empirische Grundlagen der kriterienorientierten Aussageanalyse", Zeitschrift für experimentelle und angewandte Psychologie 39, 151-170.
- Steller, Max (1988) Die vierte Phase der Aussagepsychologie. Kommentar zu Michealis-Arntzen, E.: Unglaubwürdige Zeugenaussagen. Forensia 8:73-80 (1987). Forensia 9, 23, 23-28.
- Steller, M. & Köhnken, G. (1989). Criteria-based statement analysis. Credibility assessment of children’s statements in sexual abuse cases. In: Raskin, D. C. (1989, Ed.). Psychological methods for investigation and evidence (pp. 217-245). New York: Springer
- Steller, M. & Volbert, R. (1997, Hg.). Psychologie im Strafverfahren. Ein Handbuch. Bern: Huber.
- Steller, M. & Volbert, R. (1997, Hg.). Glaubwürdigkeitsbegutachtung. In: Steller, M. & Volbert, R. (1997, Hg.), 12-39.
- Steller, M. (1998). Aussagepsychologie vor Gericht - Methodik und Probleme von Glaubwürdigkeitsgutachten mit Hinweisen auf die Wormser Missbrauchsprozesse. Recht und Psychiatrie, 16 (1), 11 - 18.
- Steller, Max & Volbert, Renate (1999) Wissenschaftliches Gutachten. Forensisch-aussagepsychologische Begutachtung (Glaubwürdigkeitsbegutachtung). [Themenheft BGH Gutachten Aussagepsychologie] In Praxis der Rechtspsychologie 9,2, 46-112. Zusammenfassende Beantwortung des Fragenkatalogs des BGH, 107-112.
- Steller, M. (2002). Aussagepsychologie und Strafjustiz: Kooperation ohne Trauma. Neue Juristische Wochenschrift [Sonderheft zur Vollendung des 65. Lebensjahres von Gerhard Schäfer], 69-72.
- Steller, Max (2015) Nichts als die Wahrheit? Warum jeder unschuldig verurteilt werden kann, München: Heyne. [GB]
- Stern, William (1893) Die Analogie im volkstümlichen Denken. Eine psychologische Untersuchung. Berlin: Salinger.
- Stern, William (1902). Zur Psychologie der Aussage. Experimentelle Untersuchungen über Erinnerungstreue Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, Bd. 22, 315-370.
- Stern, William (1903-1906, Hrsg.). Beiträge zur Psychologie der Aussage. Mit besonderer Berücksichtigung von Problemen der Rechtspflege, Pädagogik, Psychiatrie und Geschichtsforschung. Folge I (1)-Folge II (4). Leipzig: Barth.
- Stern, William (1903) Aussagestudium. Beiträge zur Psychologie der Aussage. Erste Folge. Leipzig 1903-1904, 46-78.
- Stern, William (1903) Bericht zu dem Aufsatz von Arthur Wreschner: "Zur Psychologie der Aussagen" (Erschienen in Archiv für die gesamte Psychologie 1, 148-183). Beiträge zur Psychologie der Aussage, Folge I (2), 123-127.
- Stern, William (1904) Die Aussage als geistige Leistung und als Verhörsprodukt. Experimentelle Schüleruntersuchungen. Erster Teil Beiträge zur Psychologie der Aussage 1904, Heft 3, 1-148. Einen zweiten Teil habe ich bislang (29.07.2017) nicht gefunden.
- Stern, William (1904 Das Aussageproblem auf dem Kongreß für Experimentelle Psychologie in Gießen (17.-21. April 1904). Beiträge zur Psychologie der Aussage, Folge I (3), 121.
- Stern, William (1904 Bericht über einen experimentellen Kurs zur Psychologie der Aussage. Beiträge zur Psychologie der Aussage, Folge II (1), 121-128.
- Stern, William (1904) Leitsätze über die Bedeutung der Aussagepsychologie für das gerichtliche Verfahren. Allgemeine österreichische Gerichtszeitung 55, 447-450, 457-458.
- Stern, William & Stern, Clara (1909) Erinnerung, Aussage und Lüge in der ersten Kindheit (= Monographien über die seelische Entwicklung des Kindes, Band 2) Leipzig: Barth.
- Stern, William (1904) Die Aussage als geistige Leistung und als Verhörsprodukt. Experimentelle Schüleruntersuchungen. Erster Teil. Beiträge zur Psychologie der Aussage, Folge I (3), 1-115.
- Stern, William (1904) Das Aussageproblem auf dem Kongreß für Experimentelle Psychologie in Gießen (17.-21. April 1904). Beiträge zur Psychologie der Aussage, Folge I (3), 121.
- Stern, William (1904) Bericht über einen experimentellen Kurs zur Psychologie der Aussage. Beiträge zur Psychologie der Aussage, Folge II (1), 121-128.
- Stern, William (1904) Über Schätzungen, insbesondere Zeit- und Raumschätzungen (Aus dem Psychologischen Seminar der Universität Breslau). Beiträge zur Psychologie der Aussage, Folge II (1), 32-72.
- Stern, William (1904) Wirklichkeitsversuche. Beiträge zur Psychologie der Aussage, Folge II (1), 1-31.
- Stern, William & Stern, Clara (1905) Erinnerung und Aussage in der ersten Kindheit. Ein Kapitel aus der Psychogenesis eines Kindes. Beiträge zur Psychologie der Aussage, Folge II (2), 31-67.
- Stern, William (1905 Forderungen für das gerichtliche Verfahren, auf Grund von Ergebnissen der Aussagepsychologie. Die Umschau 9 (25), 487-490.
- Stern, William (1905) Der Gefühlsablauf bei Bildbetrachtungen. Beiträge zur Psychologie der Aussage, Folge II (3), 159-160.
- Stern, William (1905) Leitsätze über die Bedeutung der Aussagepsychologie für das gerichtliche Verfahren. Beiträge zur Psychologie der Aussage, Folge II (2), 73-80 (erstmals erschienen in: Allgemeine Österreichische Gerichtszeitung 55, 447-450,
- Stern, William (1905) "Psychologische Tatbestandsdiagnostik". Beiträge zur Psychologie der Aussage, Folge II (2), 145-147.
- Stern, William (1905) Selbstverrat durch Assoziation. Beiträge zur Psychologie der Aussage, Folge II (3), 150-155.
- Stern, William & Kramer, F. (1905) Selbstverrat durch Assoziation. Experimentelle Untersuchungen. Beiträge zur Psychologie der Aussage, Folge II (4), 1-32.
- Stern, William (1906) Bemerkungen zu: GOTTSCHALK, A. "Zur Zeugenpsychologie". Beiträge zur Psychologie der Aussage, Folge II (4), 104-110.
- Stern, William (1906) Kleine Bibliographie zum Aussageproblem. Beiträge zur Psychologie der Aussage, Folge II (4), 119-123.
- Stern, William (1906) Über stenographische Protokollierung der Zeugenaussagen. Beiträge zur Psychologie der Aussage, Folge II (4), 145-148.
- Stern, William (1908) Literatur zur Psychologie der Aussage. Zeitschrift für angewandte Psychologie und psychologische Sammelforschung 1, 429-450.
- Stern, William (1908) Zur Psychologie der Kinderaussagen. Deutsche JuristenZeitung 13, 51-57.
- Stern, William (1909) Zur Reform der Zeugenvernehmung vom Standpunkt der Psychologie. Deutsche Juristen-Zeitung 14, 408-412.
- Stern, William (1910) Kinder und Jugendliche als Zeugen. Deutsche Juristen-Zeitung 15, 1001-1004.
- Stern, William (1911) Bibliographie zur Psychologie der Aussage. 1908-1910. Zeitschrift für angewandte Psychologie und psychologische Sammelforschung 4, 378-381.
- Stern, William (1913) Psychologisch-statistische Untersuchungen über das schriftliche Darstellen an Knaben und Mädchen der Volksschule. Beitrag zum 3. Deutschen Kongreß für Jugendbildung und Jugendkunde in Breslau, Oktober 1913. Arbeiten des Bundes für Schulreform 7, 6-11.
- Stern, William (1914) Eigenschaften der frühkindlichen Phantasie. Zeitschrift für pädagogische Psychologie und experimentelle Pädagogik 15, 305-313.
- Stern, William (1915) Über Intelligenz-Stadien und -Typen beim Aussageversuch. Kritische Besprechung. Zeitschrift für angewandte Psychologie und psychologische Sammelforschung 10, 300-320.
- Stern, William & Stern, Clara (1920) Erinnerung, Aussage und Lüge in der ersten Kindheit (= Monographien über die seelische Entwicklung des Kindes, Band 2). 2. A. Leipzig: Barth.
- Stern, William (1921) Die Zeugenaussage Jugendlicher und die künftige Strafprozessordnung. Zeitschrift für angewandte Psychologie 18, 196-199.
- Stern, William & Stern, Clara (1922) Die Kindersprache. Eine psychologische und sprachtheoretische Untersuchung (= Monographien über die seelische Entwicklung des Kindes, Band 1) Leipzig: Barth.
- Stern, William (1925) Psychologische Gutachten in Sexualprozessen. In: LESCH, E. (Ed.) Bericht über den 2. Kongreß für Heilpädagogik in München, 29.7.-1.8.1924. Berlin: Springer. p. 236-239.
- Stern, William (1925) Suggestion und Suggestibilität in Kindheit und Jugendalter. In: KUESTER, H. (Ed.) Erziehungsprobleme der Reifezeit. Leipzig: Quelle & Meyer. p. 44-56.
- Stern, William (1926). Jugendliche Zeugen in Sittlichkeitsprozessen. Leipzig: Quelle & Meyer.
- Stern, William (1926 Sittlichkeitsvergehen an Kindern und Jugendlichen. Zeitschrift für pädagogische Psychologie, experimentelle Pädagogik und jugendliche Forschung 27, 45-51, 73-80.
- Stern, William (1927) Psychologische Begutachtung jugendlicher Zeugen in Sexualprozessen. Kriminalistische Monatshefte. Zeitschrift für die gesamte kriminalistische Wissenschaft und Praxis 1, 35.
- Stern, William (1928) Mehr Psychologie im Vorverfahren von Sittlichkeitsprozessen. Betrachtungen zu zwei Freispruchsfällen. Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform 19, 8-17. Stern, William (1933) Zum Thema: Psychologie und Wiederaufnahme. Eine Vorbemerkung zu der folgenden Abhandlung [STERN, F. & SACKSOFSKY,? Beitrag zur Psychologie der Aussage bei Sittlichkeitsverbrechen] . Zeitschrift für angewandte Psychologie 45, 54-56.
- Stern, William (1930) Personalistik der Erinnerung. Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. I. Abteilung. Zeitschrift für Psychologie 118, 350-381.
- Stern, William (1930) Zwei forensisch-psychologische Gutachten über kindliche Zeugen in Sittlichkeitsprozessen. Zeitschrift für angewandte Psychologie 36, 151-173.
- Stern, William (1931) Dauerphantasien im 4. Lebensjahre. Zeitschrift für angewandte Psychologie 38, 309-324.
- Stern, William & Stern, Clara (1931) Erinnerung, Aussage und Lüge in der ersten Kindheit (= Monographien über die seelische Entwicklung des Kindes, Band 2). 4. A. Leipzig: Barth.
- Stern, William (1937) Cloud pictures: A new method for testing imagination. Character & Personality 6, 132-146.
- Szewczyk, H., (1983). "Psychologie der Aussage", in: "Kriminalität und abweichendes Verhalten", Bd. 2 in "Kindlers Psychologie des 20. Jahrhunderts", Hrsg. von H. J. Schneider, 171-186, Weinheim: Beltz.
- Trankell, A. (dt. 1971, 1963 orig.). "Der Realitätsgehalt von Zeugenaussagen. Methodik der Aussagepsychologie", dt. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
- Undeutsch, U. (1956). Eine grundsätzliche Entscheidung des Bundesgerichtshofes über die Zuziehung von Sachverständigen zur Beurteilung von Aussagen Minderjähriger. In A. Dührssen & W. Schwidder (Hrsg.), Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie. (S. 67 - 69). Göttingen: Verlag für Medizinische Psychologie.
- Undeutsch, U. (1957). Aussagepsychologie. In A. Ponsold (Hrsg.), Lehrbuch der gerichtlichen Medizin. 2. Auflage (S. 191-219) Stuttgart: Thieme.
- Undeutsch, U. (1967). "Beurteilung der Glaubhaftigkeit von Aussagen", in: "Forensische Psychologie", Handbuch der Psychologie Bd. 11, 26-181. Göttingen: Hogrefe.
- Undeutsch, Udo (1989). Exploration verheimlichter Sachverhalte auf verhaltenstheoretischer Basis. In: Salzgeber, Josph (1989, Hrsg.). Glaubhaftigkeitsbegutachtung. München: Profil. S. 32-85.
- Undeutsch, U. (1993). Die aussagepsychologische Realitätsüberprüfung bei Behauptung sexuellen Missbrauchs. In S. Kraheck-Brägelmann (1993, Hrsg.), Die Anhörung von Kindern als Opfer sexuellen Missbrauchs (S. 69 - 162). Rostock: Hanseatischer Verlag für Wissenschaft.
- Volbert, Renate (2002) Zur Zuverlässigkeit von Erinnerungen an persönlich bedeutsame Erlebnisse. Habilitationsschrift, Freie Universität Berlin
- Volbert, Renate (2004). Beurteilung von Aussagen über Traumata. Erinnerungen und ihre psychologische Bewertung. Bern: Huber.
- Volbert, R. (2008). Glaubhaftigkeitsbegutachtung - mehr als Merkmalsorientierte Inhaltsanalyse. Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie, 2(1), 12- 19.
- Volbert, R. (2009). Glaubhaftigkeitsbegutachtung. Wie man die aussagepsychologische Methodik verstehen und missverstehen kann. Kindesmisshandlung und -Vernachlässigung, 12(2), 52 - 69.
- Volbert, R., Steller, M. & Galow, A. (2010). Das Glaubhaftigkeitsgutachten. In H.-L. Kröber, D. Dölling, N. Leygraf & H. Sass (Hrsg.), Handbuch der Forensischen Psychiatrie. Bd. 2 (S. 623 - 689) Berlin: Springer.
- Volbert, Renate & Dahle, Klaus-Peter (2010) Forensisch-psychologische Diagnostik im Strafverfahren. Göttingen: Hogrefe.
- Volbert, Renate (2010) Aussagepsychologische Begutachtung. In (18-66) Volbert, Renate & Dahle, Klaus-Peter (2010).
- Volbert, Renate & May, Lennart (2016) Falsche Geständnisse in polizeilichen Vernehmungen – Vernehmungsfehler oder immanente Gefahr? R & P, 34, 4–10.
- Wehner, I. (2006). Erhebung und Beurteilung von Tatverdächtigenaussagen. Frankfurt: Verlag für Polizeiwissenschaft.
für die gesamte kriminalistische Wissenschaft und Praxis 4, 76-79.
457-458) (zugleich 1905 erschienen in: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 26, 180-188).
c) Spezialproblem Zeitschaetzungen und zeitliche Zuordnungen (siehe auch)
c1) Allgemeine Biologie, Psychologie und Psychopathologie der Zeit
- Dutke, S. (1997). Erinnern der Dauer. Zur zeitlichen Rekonstruktion von Handlungen und Ereignissen. Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Fraisse, P. (dt. 1985). Psychologie der Zeit. Konditionierung, Wahrnehmung, Kontrolle, Zeit-schätzung, Zeitbe-griff. München: Reinhardt.
- Und eine bedeutsame psychiatrische Monographie zum Zeitproblem verdanken wir:
- Payk, T. R. (1979). Mensch und Zeit. Chronopathologie im Grundriß. Stuttgart: Hippokrates.
- Pöppel, E. (1987). Time perception. Encyclopedia of Neuroscience, 1215-1216.
- Winfree, A. T.; u. a. (dt. 1988). Biologische Uhren. Zeitstrukturen des Lebendigen. Heidelberg: Spectrum.
- Arntzen (1983 S. 61, 1993 S. 60).
Anmerkung: Weder Undeutsch (1967) noch Köhnken (1990) erfassen Zeitprobleme in ihren Sachregistern.
Diagnostische Probleme (Puppen, Zeichnungen)
- Dungen van den, M. (1994). "Entgleiste Puppen: Berufsordnung und Psychodiagnostik", Report Psychologie 9, 28-33 (Essential: Suggestiver und projektiver Einsatz problematisch und nicht schlüssig)
- Ekman, P. (1990). Zur Problematik der Diagnostik mit Hilfe von anatomisch genau nachgebildeten Puppen in: "Warum Kinder lügen", Hamburg 1990 (orig. 1989), S. 257f.
- Steinhage, R. (1992). Sexuelle Gewalt - Kinderzeichnungen als Signal. Reinbek: Rowohlt.
- Wetzels, P. (1993). "Anatomisch ausgebildete Puppen: Ein diagnostisches Mittel für die forensische Praxis", Praxis der Rechtspsychologie 3(2), 88-107 {Essential: zurückhaltend verwendbare Explorationshilfe; bei nicht mißbrauchten Kindern kam in 6 % - 20 % der Fälle Demonstration von Geschlechtsverkehr vor}
- Yapko, M. D. (dt. 1996, orig. 1994). Fehldiagnose Sexueller Mißbrauch. München: Knaur.
Aussagepsychologie, Persoenlichkeitsstoerungen und Traumata
- Böhm, C. & Lau, S. (2005) Persönlichkeitsstörungen: Entwicklungspsychopathologie und aussagepsychologische Beurteilung. In (330–343) Dahle KP, Volbert R (Hrsg.) Entwicklungspsychologische Aspekte der Rechtspsychologie. Hogrefe: Göttingen.
- Böhm, C. & Lau, S. (2007) BorderlinePersönlichkeitsstörung und Aussagetüchtigkeit. Forens Psychiatr Psychol Kriminol, 1, 50–58.
- Böhm, H.; Meuren, R. & StormWahlich, M. (2002) Die Borderlinestörung als Quelle (nicht)intentionaler Falschaussagen. Praxis der Rechtspsychologie, 12: 209–223.
- Hinckeldey, Sabine von & Fischer, Gottfried (2002). Kapitel 8 Psychotraumatologie der Zeugenaussage und Begutachtung vor Gericht in (156-186): Psychotraumatologie der Gedächtnisleistung. München: Reinhardt UTB.
- Lau, S.; Böhm, C. & Volbert, R. (2008). Psychische Störung und Aussagetüchtigkeit. Nervenarzt 79, :60-66.
- Rautenstrauch, R. (2006) Selbstpräsentationsstrategien in Falschaussagen von Frauen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen, Diplomarbeit Berlin Charité, 2006.
- Rohmann, JA (2003) BorderlinePersönlichkeitsstörung und aussagepsychologische Begutachtung Ein Beitrag zur Diskussion. Praxis der Rechtspsychologie, 13: 329–344.
- Rückert S (2007) Unrecht im Namen des Volkes. Hamburg: Hoffmann & Campe.
- Volbert, R. (2004): Beurteilung von Aussagen über Traumata. Bern: Huber.
- Stang, K. & Sachsse, U. (2014) Trauma und Justiz. Juristische Grundlagen für Psychotherapeuten – psychotherapeutische Grundlagen für Juristen Stuttgart: Schattauer.
Entwicklungspsychologie
und Aussagepsychologie
- Böhm, Claudia & Lau, Steffen (2005) Persönlichkeitsstörungen: Entwicklungspsychopathologie und aussagepsychologische Beurteilung In (330-343) Dahle, KP, Volbert, R. (2005, Hrsg.)
- Dahle, KP, Volbert, R. (2005, Hrsg.) Entwicklungspsychologische Aspekte der Rechtspsychologie. Hogrefe: Göttingen.
- Erdmann, Katja; Busch, Michaela & Jahn, Broder (2005) Langzeitentwicklung suggerierter Pseudoerinnerungen bei Kindern In (306-317) Dahle, KP, Volbert, R. (2005, Hrsg.)
- Kagan, J. (dt. 1987, orig. 1984). Die Natur des Kindes. München: Piper.
- Kotre, John (dt. 1996, eng. 1995). Weisse Handschuhe. Wie das Gedächtnis Lebensgeschichten schreibt. München.
- Kruse, O. (1991). Emotionsentwicklung und Neuroseentstehung. Perspektiven einer klinischen Entwicklungspsychologie.
- Müller-Johnson, Katrin & Ceci, Stephen J. (2005) Zur suggestiven Beeinflussbarkeit von älteren Menschen In (318-329) Dahle, KP, Volbert, R. (2005, Hrsg.)
- Niehaus, Susanna (2005) Täuschungsstrategien von Kindern und Erwachsenen In (279-294) Dahle, KP, Volbert, R. (2005, Hrsg.)
- Oerter, R. & Montada, L. (f1982, Hg.). Entwicklungspsychologie. München: Urban & Schwarzenberg.
- Oser, F. & Althof \ , W. (1992). Moralische Selbstbestimmung. Modelle der Entwicklung und Erziehung im Wertebereich. Ein Lehrbuch. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Piaget, J. (1975). Gesammelte Werke 1-10. Studienausgabe. Stuttgart: Klett.
- Reimann, Bernd (2005) Zeitlichkeitsbezüge und ihr Erlebniskontext in der frühen Kindersprache In (258-270) Dahle, KP, Volbert, R. (2005, Hrsg.)
- Schönpflug, Ute (2005) Wörtliches und inhaltliches Erinnern gehörter Erzählungen bei Kindern In (271-278) Dahle, KP, Volbert, R. (2005, Hrsg.)
- Stucki, Ingrid; Bütikofer, Andrea & Oswald, Margit E. (2005) Einfluss eines Erzählverbots auf die Wiedergabeleistung von Vorschulkindern In (295-305) Dahle, KP, Volbert, R. (2005, Hrsg.)
- Volbert, Renate (2005) Die Entwicklung von Aussagefähigkeiten, In (241-257) Dahle, K.P., Volbert, R. (2005, Hrsg.)
- Bach, K.R.; Grassel, H. (1979, Hg.). "Kinder- und Jugendsexualität", Berlin: VEB der Wissenschaften.
- Bach, K.R.; Stumpe, H.; Weller, K. (1993, Hg.). "Kindheit und Sexualität", Braunschweig: Holtzmeyer.
- Bornemann, E. (1988). "Das Geschlechtsleben des Kindes", München: dtv.
- Bell, R. (1993, Hg.) . "Wie wir werden, was wir fühlen. Ein Handbuch für Jugendliche über Körper, Sexualität, Beziehungen", Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Broderick, C. B. (1975). "Kinder- und Jugendsexualität. Sexuelle Sozialisierung. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Fietzek, E. (1987). "Mädchensexualität. Eine empirische Untersuchung mit qualitativen und quantitativen Analysen zu Wissen, Erfahrungen und Einstellungen im Bereich der Sexualität durchgeführt mit Mädchen im Alter von acht bis sechszehn Jahren aus benachteiligtem sozioökonomischen Milieu.", unveröff. Diplom-Arbeit PI Uni-versität Erlangen-Nürnberg.
- Wottawa, W. (1979). "Alter des ersten heterosexuellen Geschlechtsverkehrs", in: "Das sexuelle Verhalten der Deutschen", Tab. 18, S. 554. Rastatt: Moewig.
Sexuell Abweichendes Verhalten (siehe auch)
- Bisexualität:
- Kuntz-Brunner, R. (1994). Bisexualität. Doppelte Sehnsucht - Doppelte Scham. Reinbek: Rowohlt.
- Master, W. H. & Johnson V. E. (1979). Die ambisexuelle Studiengruppe. In: Master, W. H. & Johnson V. E. (1979), 137-160.
Homosexualitaet
- Dannecker, M. & Reiche, R. (21975). Der gewöhnliche Homosexuelle. Eine soziologische Untersu-chung über männliche Homosexuelle in der Bundesrepublik. Frankfurt: S. Fischer.
- Frings, M. & Kraushaar, E. (1982). Männer Liebe. Ein Handbuch für Schwule und alle, dies es werden wollen. Reinbek: Rowohlt.
- Master, W. H. & Johnson V. E. (1979). Homosexualität. Berlin: Ullstein.
- Masochismus und Sadismus:
- Doucet, F.W. (1967). Sadismus und Masochismus. München: Lichtenberg.
- Schorsch, E. & Becker, N. (1977). Angst, Lust, Zerstörung. Sadismus als soziales und kriminelles Han-deln. Zur Psychodynamik sexueller Tötungen. Reinbek: Rowohlt.
Paedophilie, Paedophile, Paedosexualitaet, Paedokriminelle
- Bornemann, E. (1978). Pädophilie. Stichwort in: Lexikon der Liebe, Bd. 3, 1011-1016. Berlin: Ullstein.
- Fischer, A. (1965). Probleme des Sachverständigengutachtens in der Pädophilie. In: Stockert, F. G. v. (1965, Hg.), 30-41.
- Giese, H. (1965). Zur Diagnose Pädophilie. In: Stockert, F. G. v. (1965, Hg.), 24-29.
- Huber, G. (1965). Zur forensisch-psychiatrischen Begutachtung pädophiler Sexualdelinquenten. In: Stockert, F. G. V. (1965, Hg.), 42-55.
- Potrykus, D.; Wöbcke, M. (1974). Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen. München: Goldmann
- Stumpfl, F. (1965). Die Persönlichkeit des Pädophilen. In: Stockert, F. G. v. (1965, Hg.), 1-17.
- Stockert, G. F. von (1965, Hg.). Die Pädophilie und ihre strafrechtliche Problematik. Stuttgart: Enke.
Sexualitaet und Sexueller Mißbrauch in Kirche, Sekten, Religion [siehe auch]
- Burkett, Elinor & Bruni, Frank (dt. 1997, engl. 1993). Das Buch der Schande. Kinder und sexueller Mißbrauch in der katholischen Kirche. München: Piper.
- Cawthorne, Nigel (1999). Das Sexleben der Päpste. Die Skandalchronik des Vatikans. Köln: Benedikt.
- Curb, Rosemary & Manahan, Nancy (dt. 1996, engl. 1985). Die ungehorsamen Bräute Christi. Lesbische Nonnen brechen das Schweigen. München: Kindler.
- Denzler, Georg (1989). Lebensbericht verheirateter Priester. Autobiographische Berichte verheirateter Priester. München: Piper.
- Mynarek, Hubertus (1980). Eros und Klerus. Vom Elend des Zölibats. München: Knaur.
- Smith, Maragaret (1994). Gewalt und sexueller Mißbrauch in Sekten. Zürich: Kreuz.
Sexueller Mißbrauch & Vergewaltigung Mißbrauch des Mißbrauchs
- Abel, M. H. (1988). Vergewaltigung. Stereotypien in der Rechtsprechung und empirische Befunde. Weinheim: Beltz.
- Adams, Caren & Fay, Jennifer (dt. 1989, engl. 1981) Ohne falsche Scham. Wie Sie Ihr Kind vor sexuellem Mi0brauch schützen können. Reinbek: Rowohlt.
- Amann, G. & Wipplinger, R. (1997, Hg.). Sexueller Mißbrauch. Überblick zur Forschung. Beratung und Therapie. Ein Handbuch. Tübingen: dgvt.
- Braeker, S.; Wirtz-Weinrich, W. (2A., 1992). Sexueller Mißbrauch an Mädchen und Jungen. Handbuch für Interven-tions- und Präventionsmöglichkeiten. Weinheim: Beltz.
- Delfs, Hans (2020) Sexueller Missbrauch: Falsche Erinnerungen durch Psychotherapie. Skeptiker 3/2020, 112-120
- Dörr, S. A.; Schulze-Berndt, A. (1992). Zum Umgang mit dem Verdacht des sexuellen Mißbrauchs. Eine Gegenrede aus der fachfraulichen Praxis zu Offe/ Offe/ Wetzels. Neue Praxis (5), 434-438.
- Fegert, J. M. (1993). Sexuell mißbrauchte Kinder und das Recht. Bd. 2. Ein Handbuch zu Fragen der kinder- und jugendpsychiatrischen und psychologischen Untersuchung und Begutachtung. Köln: Volksblatt-Verlag.
- Feldmann, H. (1992). Vergewaltigung und ihre psychischen Folgen. Stuttgart: Enke.
- Geisler, E. (1959). Das Sexuell Missbrauchte Kind. \ Beiträge zur sexuellen Entwicklung, ihrer Gefährdung und zu forensischen Fragen. Göttingen: Verlag für medizinische Psychologie.
- Heinrichs, J. (1986, Hg.). Vergewaltigung. Die Opfer und ihre Täter. Braunschweig: Holtzmeyer.
- Jungjohann, E. (1992). Kinder klagen an. Angst, Leid und Gewalt. Reinbek: Rowohlt.
- Kluck, M-L. (1995). Verdacht auf sexuellen Mißbrauch und familiengerichtliches Verfahren - Probleme der Entstehung und der Prüfung. FPR 03, 56-59.
- Lachmann, J. (1988). Psychische Schäden nach 'gewaltlosen' Sexualdelikten an Kindern und Abhängigen - Positionen und Probleme empirischer Forschung. Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 71(1), 47-60 {Essential: differenzierte Berichterstattung über Schäden}
- Mai, S. (1992). Was gibt es eigentlich Neues über den Umgang mit dem Verdacht des sexuellen Mißbrauchs? Zu Offe/ Offe/ Wetzels in der np 3/92, 547-548.
- Maisch, H. (1968). Inzest. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt.
- Martin, L. C. (Dt. 1994, orig. 1992). Vergewaltigung. Wie Frauen sich schützen können. München: Knaur.
- Michaelis-Arntzen, E. (21994). Die Vergewaltigung aus kriminologischer, viktimologischer und aussagepsycholo-gischer Sicht. 2. A., München: C.H. Beck.
- Offe, H.; Offe, S.; Wetzels, P. (1992). Zum Umgang mit dem Verdacht des sexuellen Kindesmißbrauchs. Neue Praxis (3), 240-256. Siehe auch Gegenreden: Dörr, S. A.; Schulze-Berndt, A. (1992) und Mai, S. (1992).
- Ofshe, R. & Watters, F. (dt. 1996, orig. 1994). Die mißbrauchte Erinnerung. Von einer Therapie, die Väter zu Tätern macht. München: dtv.
- Potrykus, D.; Wöbcke, M. (1974). Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen. München: Goldmann.
- Schubbe, O. (1994). Symbolische Mitteilungen sexuellen Mißbrauchs. In: Schubbe, O. (Hg.) "Therapeutische Hil-fen gegen sexuellen Mißbrauch an Kindern", 48-78. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht. {Essential: Verglei-chende Analyse der Arbeiten (S.58):
- Steinhage, R. (1989). Sexueller Missbrauch an Mädchen. Ein Handbuch für Beratung und Therapie. Reinbek: Rowohlt.
- Walter, J. (21992, Hg.). Sexueller Mißbrauch im Kindesalter. Heidelberg: HVA, Edition Schindele.
Sexueller Mißbrauch und Vergewaltigung von Jungen
- Bange, D. & Boehme, U. (21998). Sexuelle Gewalt an Jungen. In: Amann, G. & Wipplinger, R. (1997, 21998 Hg.), 726-737.
- Broek, Jos van den (dt. 1993, orig. 1991). Verschwiegene Not. Sexueller Mißbrauch an Jungen. Zürich: Kreuz.
- Glöeer, N. (1992). Sexueller Mißbrauch von Jungen. In: Walter, J. (21992, Hg.), S. 55-67
Videos
- Das getaeuschte Gedaechtnis
mit
geänderten Infotext und Bezugsrahmen, [Wiederholung vom 22.09.16]
Film von Klaus Neumann und Hendrik Löbbert
"Nicht alles, woran wir uns erinnern, ist wahr. Manche Erinnerungen gaukeln uns Ereignisse vor, die anders oder gar nicht stattgefunden haben. Und das kann gerade vor Gericht fatale Folgen haben.
Falsche Erinnerungen lassen Augenzeugen Verdächtige identifizieren, die sie nie getroffen haben. Sie schaffen Opfer sexueller Gewalt, wo es gar kein Verbrechen gab. Die Dokumentation ergründet, unter welchen Bedingungen falsche Erinnerungen entstehen.
Am Beispiel realer Fälle zeigt der Film, wie folgenschwer diese Scheinerinnerungen vor Gericht sein können - für Angeklagte und Kläger.
Unser Rechtsystem kennt nur eine Wahrheit. Nur eine Version der Realität bleibt nach dem Richterspruch bestehen. Welche Version das ist, wird oft durch Erinnerungen bestimmt. Dabei stößt das Gedächtnis auf eine ganze Reihe von Hindernissen, die einzelne Erinnerungen verändern oder komplett neu entstehen lassen können. Die Zeit, die zwischen Verbrechen und Verhandlung verstreicht, der Druck der Ermittler auf einen Zeugen oder die Kraft des kollektiven Gedächtnisses einer ganzen Gesellschaft - das alles entfaltet seine jeweils eigene Wirkung. Diesen Einflüssen kann jeder ausgesetzt sein - auch jenseits des Gerichtssaals. Wie aber können unsere Gerichte falsche Erinnerungen erkennen? Und wie lässt sich die Entstehung von Scheinerinnerungen am besten vermeiden? Der Zuschauer erfährt in mehreren Experimenten auch am eigenen Leib, wie leicht falsche Erinnerungen entstehen können.
Zu Wort kommen führende Gedächtnisforscher, Neurologen und Rechtspsychologen wie Elizabeth Loftus, Max Steller und Julia Shaw. Elizabeth Loftus ist eine der bedeutendsten Psychologinnen des 20. Jahrhunderts. Sie hat die Forschung zum menschlichen Gedächtnis geprägt und war in über 250 Gerichtsverfahren Gutachterin zur Glaubwürdigkeit von Zeugenerinnerungen. Max Steller gilt als einer der einflussreichsten Rechtspsychologen Deutschlands. Vor allem sein Gutachten bei den Wormser Prozessen in den 1990er Jahren sorgte für großen Wirbel. Julia Shaw gilt als der Shootingstar der Erinnerungsforschung. Sie hat es geschafft, Probanden die Erinnerung an Straftaten einzupflanzen, die sie nie begangen haben.
Redaktionshinweis: In 3sat steht der Donnerstagabend im Zeichen der Wissenschaft: Um jeweils 20.15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften, Kultur und Technik. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel über ein verwandtes Thema."
- Das
getaeuschte Gedaechtnis am Donnerstag, 22. September 2016 ab 20.15
Uhr in 3sat und in der Mediathek.
"Das getäuschte Gedächtnis
Falsche Erinnerungen vor Gericht
Erinnerungen können trügen. Psychologen
und Kriminologen wissen: Auf Augenzeugen ist wenig Verlass, auch wenn die
in bester Absicht handeln. Doch wovon viele Psychologen und Kriminologen
längst überzeugt sind, ist im Justizsystem, bei der Polizei und
im Alltag noch neu. Zeugenaussagen anzuzweifeln ist unbeliebt, einige Experten
werden als "Täterschützer" kritisiert. Die Befragungstechniken
von Ermittlern und die Arbeit von Therapeuten auf die neuen Erkenntnisse
einzustellen, ist ein langwieriger Prozess. Doch das Zweifeln am Gedächtnis
kann für Justiz und Gesellschaft einen positiven Effekt haben, ist
Psychologin Elizabeth Loftus überzeugt: weniger Uschuldige aufgrund
falscher Erinnerungen zu verurteilen.
Falsche Erinnerungen, vielleicht der falsche
Täter
"Die Erinnerung hinterlässt keinen Abdruck
im Gehirn, den man jederzeit wieder abrufen kann - tatsächlich ist
das Gedächtnis formbar", sagt Loftus. Vielleicht wurde nach dem Lockerbie-Attentat
ein Unschuldiger hinter Gitter gebracht: 1988 explodiert auf einem Flug
von London nach New York, direkt über der schottischen Kleinstadt
Lockerbie, eine Bombe. Alle 259 Insassen kommen ums Leben, 11 weitere Menschen
am Boden sterben. Für das Attentat wird Jahre später ein libyscher
Geheimdienstoffizier verurteilt. Die Anklage basierte primär auf den
Angaben eines Augenzeugen, der über Jahre hinweg von der Polizei befragt
wurde und Fotos von Verdächtigen sah. Schließlich identifizierte
er den später Verurteilten.
Doch Psychologen und Kriminologen
erklären, dass der Augenzeuge den Verdächtigen bei einer Gegenüberstellung
womöglich nur anhand der zuvor gesehenen Fotos wiedererkannte - und
diese mit den ursprünglichen Erinnerungen verknüpfte. Falsche
Zeugenaussagen haben der Organisation "Innocence Project" zufolge zu 242
der 343 Fehlurteile in den USA beigetragen, die bislang durch DNA-Tests
aufgehoben wurden.
Falsche Erinnerungen machen zum Opfer oder
zum Täter
Durch wohlgemeinte Beratungen und Therapien sind
seit den 1990er Jahren bei Menschen, die subjektiv überzeugt sind,
Opfer von Kindesmisshandlungen zu sein, falsche Erinnerungen entstanden.
Diese können einer Person suggeriert werden, denn das Gehirn füllt
Lücken, die im Gedächtnis existieren, mit plausibel erscheinenden
Erinnerungsstücken.Falsche Erinnerungen können nicht nur die
Taten anderer betreffen, wie die Kriminologin Julia Shaw zeigt. In einer
Studie konnte sie in mehreren Befragungen Testpersonen Kindheits- oder
Jugenderinnerungen an Straftaten einreden. Bei 70 Prozent der Personen
war sie erfolgreich."
Glossar, Anmerkungen und Endnoten:
1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
Eigener wissenschaftlicher Standort:
. |
einheitswissenschaftliche
Sicht. Ich vertrete neben den Ideen des Operationalismus, der Logischen
Propädeutik und einem gemäßigten
Konstruktivismus
auch die ursprüngliche einheitswissenschaftliche Idee des Wiener
Kreises, auch wenn sein Projekt als vorläufig gescheitert angesehen
wird und ich mich selbst nicht als 'Jünger' betrachte. Ich meine dennoch
und diesbezüglich im Ein- klang mit dem Wiener
Kreis, daß es letztlich und im Grunde nur eine
Wissenschaftlichkeit gibt, gleichgültig, welcher spezifischen
Fachwissenschaft man angehört. Wissenschaftliches Arbeiten folgt einer
einheitlichen und für alle Wissenschaften typischen Struktur, angelehnt
an die allgemeine
formale Beweisstruktur.
Schulte, Joachim & McGuinness, Brian (1992, Hrsg.). Einheitswissenschaft - Das positive Paradigma des Logischen Empirismus. Frankfurt aM: Suhrkamp. Geier, Manfred (1992). Der Wiener Kreis. Reinbek: Rowohlt (romono). Kamlah, W. & Lorenzen, P. (1967). Logische Propädeutik. Mannheim: BI. |
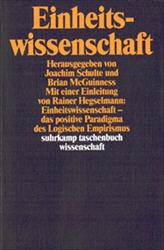 |
| Wissenschaft [IL] schafft Wissen und dieses hat sie zu beweisen, damit es ein wissenschaftliches Wissen ist, wozu ich aber auch den Alltag und alle Lebensvorgänge rechne. Wissenschaft in diesem Sinne ist nichts Abgehobenes, Fernes, Unverständliches. Wirkliches Wissen sollte einem Laien vermittelbar sein (PUK - "Putzfrauenkriterium"). Siehe hierzu bitte das Hilbertsche gemeinverständliche Rasiermesser 1900, zu dem auch gut die Einstein zugeschriebene Sentenz passt: "Die meisten Grundideen der Wissenschaft sind an sich einfach und lassen sich in der Regel in einer für jedermann verständlichen Sprache wiedergegeben." |
| Allgemeine
wissenschaftliche
Beweisstruktur
und beweisartige Begründungsregel
Sie ist einfach - wenn auch nicht einfach durchzuführen - und lautet: Wähle einen Anfang und begründe Schritt für Schritt, wie man vom Anfang (Ende) zur nächsten Stelle bis zum Ende (Anfang) gelangt. Ein Beweis oder eine beweisartige Begründung ist eine Folge von Schritten: A0 => A1 => A2 => .... => Ai .... => An, Zwischen Vorgänger und Nachfolger darf es keine Lücken geben. Es kommt nicht auf die Formalisierung an, sie ist nur eine Erleichterung für die Prüfung. Entscheidend ist, dass jeder Schritt prüfbarnachvollzogen werden kann und dass es keine Lücken gibt. |
LK. Laien-Kriterium. Wünschenswert ist weiterhin, dass wissenschaftliche Erkenntnisse Laien erklärbar sein sollten. Psychologisch steckt dahinter: wer einem Laien etwas erklären kann, sollte es wohl selbst verstanden haben. Siehe hierzu bitte auch das Hilbertsche gemeinverständliche Rasiermesser 1900, zu dem auch gut die Einstein zugeschriebene Sentenz passt: "Die meisten Grundideen der Wissenschaft sind an sich einfach und lassen sich in der Regel in einer für jedermann verständlichen Sprache wiedergegeben."
__
non liquet
"es ist nicht klar", nicht entscheidbar. Ein vielgehasster Sachverhalt im Recht, von Sachverständigen - unter dem Druck der Erwartungen von den Justizbehörden - vielfach nicht richtig erkannt oder missachtet. Mehr z.B.:
http://www.rechtslexikon.net/d/non-liquet/non-liquet.htm.
__
Aussagepsychologische Vernehmungs- und Gutachtenanalysen. FAQ.
Standort: Aussagepsychologie.
*
- Aussgepsychologische Wahrheitstheorie 1. Systematik der Falsch-Aussagen.
- Suggestion und Suggestivfragen. Aussagepsychologische und vernehmungstechnische Kunstfehler.
- Kinder und ZeugInnen richtig befragen bei sexuellem Mißbrauch / Vergewaltigung
- Der Schutz kindlicher Opferzeugen im Strafverfahren und die Verwendung von Videotechnologie. Die Dissertation von Kipper. Mit einem kritischen Kommentar und Aufruf von Rudolf Sponsel: Mauern Staatsanwaltschaften und Justiz zum Schaden unserer Kinder?
- Andere forensische Beweis-Methoden und Indizienquellen
- Überblick: Forensische Diagnostik, Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie in der GIPT
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
z.B. Aussagepsychologie site:www.sgipt.org. |
Information zu Dienstleistungen.
Sponsel, Rudolf (DAS). Aussagepsychologie.Erlangen IP-GIPT: https://www.sgipt.org/forpsy/aussage0.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
|
|
Veränderungen:
23.07.24 Neu: Indiz, Zeugenbeweis; BGH (1999). Ergänzung Aktuell: "Es fehlt allerdings immer noch eine klare Theorie und Ausarbeitung des Kernanliegens, wie man realerlebnisbegründete Aussagen beweisen kann. Das ist zwar schwierig und berührt auch das grundlegende Beweisthema im Recht, aber notwendig."
21.07.24 Geschichte: Arntzen eingefügt. Aktuell ergänzt.
20.07.24 Geschichte der Aussagepsychologie * Lit. Leonhardt neu nach Thomae (4 mehr und Bandinformationen) erfasst.
05.11.20 LitErg (Delfs)
22.11.17 Darstellung von Aussagen zur Aussageanalyse.
20.11.17 Strukturvergleiche neue und differenziert erfasst nach Quelle.
24.08.17 Aussgagepsychologie und Phantasie. Erste Hypothesen. [externer Link]
02.08.17 Die großen Hypothesen der Aussagepsychologie.
29.07.17 Das Grundproblem wie William Stern es schon 1903 formuliert hat.
31.03.17 Video: Das getäuschte Gedächtsnis. Lit-Nachträge: Shaw: das trügerische Gedächtnis * Sachsse: Trauma und Justiz. * Steller Wahrheit.
27.09.16 Hinweis 3sat Video Das getäuschte Gedächtnis.
19.03.15 Lit Erg.
04.02.15 Linkfehler geprüft und entfernt. (u.a. Kroeb statt Kröb)
10.01.15 Neue Rubrik: Lügendetektion.
28,08.14 Ergänzung Fachliche Ausführungen zur Hypothesenprüfung.
27.08.14 Aussage-, Wahrnehmungs-, Gedächtnis- und Kommunikationspsychologie:, Gründe für falsche Erinnerungen u.a.
25.08.14 Hypothesenprüfung. * BGH-Leitlinien zur Methodik.
15.04.14 Hinweis zur Vernehmung von geistige Behinderten.
14.04.14 Hinweis und Link zu § 136a StPO (verbotene Vernehmungsmethoden).
12.11.13 Ergänzungen:
- 1) Grundlegende
Unterscheidung zwischen Glaubhaftigkeit und Glaubwüdigkeit.
2) Verschiedene Aussageumfänge.
3) Beispiel-01 Aussagezerlegung in atomare bzw. Elementaraussagen.
4) Vergleichende Aussagenanalyse.
10.04.12 LitErg.
17.03.12 LitErg.
26.10.09 Kleine Berichtigungen bzw. Änderung.
26.06.05 Die 8 Hauptsünden in Die 12 Verbote ... erweitert.
11.08.03 Aufnahme der Arbeiten Landgerichtsdirektor Leonhardts und Lipmanns ins Literaturverzeichnis
09.08.03 Leonhardt Zitat belegt * Mittermaier Einschub und Literaturlink bei Leonhardt *
03.08.03 Acht ‘Hauptsünden’ in der Vernehmung (Exploration) von kindlichen Zeugen eingebaut